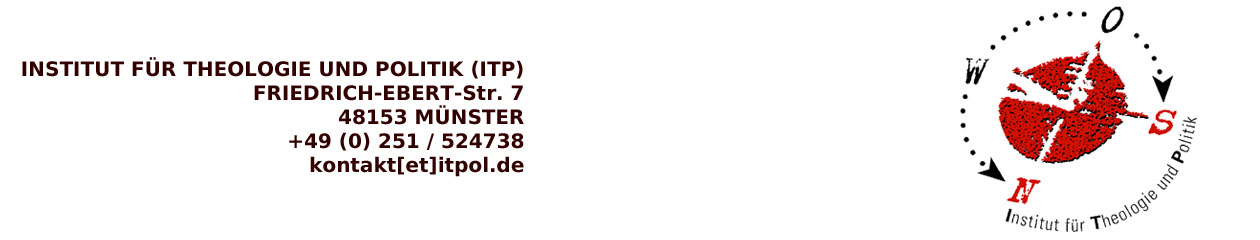Julia Lis / Michael Ramminger, Institut für Theologie und Politik, Münster
Als im März 2020 aus einer fernen Epidemie eine globale Pandemie wurde und das gesellschaftliche und öffentliche Leben weitgehend zum Stillstand kam, stellte sich für die gesellschaftlichen AkteurInnen plötzlich die Frage der Relevanz des eigenen Tuns mit neuer Dramatik. Die Herausforderung bestand und besteht darin, den gefährlichen und lebensbedrohenden Erreger ernst zu nehmen, ihn aber nicht medizinisch-technologisch isoliert zu betrachten. Stattdessen geht es darum, sozial und politisch einen kritischen Umgang mit den gesellschaftlichen Folgen der Pandemie zu finden und darin nach der Bedeutung des eigenen Tuns zu fragen. Die Bilanz, was Kirchen, Glaube und Religion in der Bundesrepublik Deutschland angeht, fiel dabei mehr als ernüchternd aus: Kaum jemand sprach ihnen eine besondere „Systemrelevanz“ (wobei „Systemrelevanz“ in diesem System eine durchaus zweifelhafte Auszeichnung ist!) zu, kaum jemand schien sie zu vermissen, als sich die Kirchen in den digitalen Raum verabschiedeten. Ostern? Absagen oder Verlegen. Gottesdienste? Dafür gibt es ja Live-Übertragungen für die wenigen, die nicht ohne können. Seelsorge? Diejenigen, die Bedarf haben, können ja eine Mail schreiben. Sakramente und rituelle Feiern? Können wir ja später nachholen.
Was so deutlich wurde: Die Kirchen haben auch für sich selbst keine befriedigende Antwort darauf, wofür sie in einer neoliberal-kapitalistischen Gesellschaft eigentlich noch relevant sein können, wieso und von wem sie genau hier noch gebraucht werden. Diese unbequemen Fragen, die am institutionellen Bestand rütteln, werden überdeckt vom Trott der eingefahrenen Aktivitäten und Traditionen, die meist unhinterfragt im Modus des „Das-haben-wir-doch-schon-immer-so-gemacht“ wiederholt werden. Als der gewohnte Lauf der Dinge aber zum Stehen kam, wurde sichtbar, wie wenig der eigenen Botschaft, Symbolsprache, der Bedeutung in und für die Welt eigentlich noch zugetraut wird. So werden auch da, wo man nach der Corona-Pause nicht gleich auf die gewohnte Weise weitermachen will, Stimmen laut, doch abzuwarten und zu schauen, wofür man noch gebraucht werde, für welche Angebote es auf dem religiösen Markt gerade überhaupt noch eine Nachfrage gebe.1
Die Unterwerfung unter den Kapitalismus
Die seit Beginn 2020 grassierende Pandemie hat somit deutlich gemacht, dass die Kirchen schon längst in der bürgerlichen Gesellschaft aufgegangen, und also auch in ihr untergegangen sind. Längst sind sie eben gerade nicht mehr die ideologischen Stützen der Gesellschaft, die dem Bestehenden Legitimität und Sinn verleihen. Die bürgerliche Gesellschaft schafft es mittlerweile auch ohne die Kirchen sich selbst zu erhalten.
 Der vorauseilende Lockdown der Kirchen, der Verzicht auf öffentliche Gottesdienste wie auch jede andere Form gesellschaftlicher Präsenz war eine stille Apokalypse, nicht als Chaos und Untergang am Ende der Welt verstanden, sondern als Offenbarung des bestehenden Chaos: Sie offenbarte das, was eigentlich schon lange virulent war, dass die Kirchen nämlich nur noch eine bescheidene Nischenexistenz in unseren Gesellschaften innehaben und resignierend darum wissen. Denn wie könnte sich das Wesen des Christentums als bedeutsam für das herrschende System darstellen, wo es doch eigentlich bedeutsam für die Überwindung des Systems sein sollte? Wir wissen, dass es heutzutage TheologInnen gibt, die das bestreiten. Sie können es aber in der Tat nur aus einer Position bestreiten, die sich längst von den jüdischen und christlichen Traditionen verabschiedet hat. Solche TheologInnen aber braucht heute eben niemand mehr, insbesondere die spätkapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft nicht, der sie sich andienen. Die Halbwertszeit dieser Theologien endet mit der Pensionierung ihrer ProduzentInnen.
Der vorauseilende Lockdown der Kirchen, der Verzicht auf öffentliche Gottesdienste wie auch jede andere Form gesellschaftlicher Präsenz war eine stille Apokalypse, nicht als Chaos und Untergang am Ende der Welt verstanden, sondern als Offenbarung des bestehenden Chaos: Sie offenbarte das, was eigentlich schon lange virulent war, dass die Kirchen nämlich nur noch eine bescheidene Nischenexistenz in unseren Gesellschaften innehaben und resignierend darum wissen. Denn wie könnte sich das Wesen des Christentums als bedeutsam für das herrschende System darstellen, wo es doch eigentlich bedeutsam für die Überwindung des Systems sein sollte? Wir wissen, dass es heutzutage TheologInnen gibt, die das bestreiten. Sie können es aber in der Tat nur aus einer Position bestreiten, die sich längst von den jüdischen und christlichen Traditionen verabschiedet hat. Solche TheologInnen aber braucht heute eben niemand mehr, insbesondere die spätkapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft nicht, der sie sich andienen. Die Halbwertszeit dieser Theologien endet mit der Pensionierung ihrer ProduzentInnen.
Die Kirchen mit ihrer Theologie haben – das hat uns die Corona-Pandemie vor Augen geführt – kein Sinn-Monopol mehr, von ihnen werden keine Antworten auf die drängenden Fragen des Lebens, Leidens und Sterbens mehr erwartet, ja sie werden ihnen noch nicht einmal mehr gestellt. Dafür sind jetzt, auch und gerade in Zeiten von Corona, primär die Wissenschaft, also die MedizinerInnen oder PsychologInnen, und die Staatsgewalt, also die PolitikerInnen und FunktionärInnen, zuständig.Von den Verfechtern der Moderne wurde eine solche Entwicklung durchaus als Emanzipationsschub verstanden: „In Europa waren die Religionen zu einer Reflexion auf ihre nicht-exklusive Stellung innerhalb eines vom wissenschaftlichen Profanwissen begrenzten und mit anderen Religionen geteilten Diskursuniversums genötigt. Erst dieser kognitive Schub hat religiöse Toleranz und die Trennung der Religion von einer weltanschaulich neutralen Staatsgewalt möglich gemacht. …“2
Die gegenwärtige Pandemie hat in der spezifischen Reaktion der meisten Kirchen und Kirchenglieder, von Rückzug sowie Aufrufen sich den staatlichen Maßnahmen zu unterwerfen dann im Grunde offenbart, dass sie recht eigentlich davor schon lange resigniert haben. Die pfiffigsten FunktionärInnen unter ihnen versuchten da noch ins Geschäft mit dem Beelzebub einzusteigen – um damit die eigene Seele zu retten oder vielleicht etwas Profit für die nächste Kirchenrenovierung herauszuschlagen, das bleibt offen. So sagt Pfarrer Stefan Wissel von der Pfarrei Sankt Martin in Barbing / Bayern zur Förderung des kontaktlosen Weihwasserspenders: „Ein junger Mann, den ich getraut habe, fördert Start-Up Firmen und der schaut immer wieder, was könnte man in den Krisenzeiten brauchen. Und da hat er sich direkt mit den Kollegen von dieser Firma zusammengesetzt und gesagt, schaut mal, da könnten wir was draus machen. Das wurde dann entsprechend auch  entworfen, ein Christus-Emblem drauf und sauber aus Edelstahl gefertigt. So ist die Sache für uns einwandfrei. Auch der Opferstock ist integriert, weil man Sammelkörbe auch nicht durchgeben darf. Also können auch die Leute ihr Geld berührungsfrei am Eingang einwerfen und letztlich auch das Weihwasser nehmen.“5 In Krisenzeiten also braucht die Kirche Weihwasserspender und berührungsfreie Opferstöcke. Damit ist wohl alles gesagt.
entworfen, ein Christus-Emblem drauf und sauber aus Edelstahl gefertigt. So ist die Sache für uns einwandfrei. Auch der Opferstock ist integriert, weil man Sammelkörbe auch nicht durchgeben darf. Also können auch die Leute ihr Geld berührungsfrei am Eingang einwerfen und letztlich auch das Weihwasser nehmen.“5 In Krisenzeiten also braucht die Kirche Weihwasserspender und berührungsfreie Opferstöcke. Damit ist wohl alles gesagt.
Die Unterwerfung unter die Vernunft?
Der Anspruch, sich den Rationalitäten der kapitalistischen Moderne in Zeiten der Pandemie zu unterwerfen, ging auch mit neuen Konflikten zwischen Glaube und Vernunft einher, die plötzlich unerwartet praktisch wurden: Soll man sich im Namen der Vernunft von den anderen fernhalten, Abstand wahren, Kontakte vermeiden, zu Hause bleiben und bestenfalls virtuell mit der Mitwelt in Kommunikation bleiben? Oder erfordert der christliche Glaube, an den Sakramenten, an der Berührung von Körpern, an der Versammlung zum Gottesdienst festzuhalten, selbst wenn dieses Tun plötzlich eine Gefahr für die Gesundheit, ja schlimmstenfalls für die Bewahrung des eigenen Lebens mit sich bringen sollte?
Schon bis zum 22. März 2020 waren in Italien mindestens 50 Priester an COVID-19 gestorben. Viele von ihnen hatten sich nicht an die Abstandsregeln und Ausgangsverbote gehalten, hatten Kranke besucht, und sich dabei infiziert.6 In Berlin hatte der konservativ-katholische „Freundeskreis St. Philipp Neri“ gegen die Gottesdienstverbote geklagt und argumentiert, dass man besser als im Supermarkt in der Kirche den Mindestabstand einhalten könne, und Gottesdienstverbote deshalb unangemessen seien.
Man kann das Verhalten, das in den beiden Beispielen auftaucht, leicht als typisch vormoderne „Realitätsverweigerung“ eines immer noch abergläubisch-gläubigen Subjekts halten, das die Autonomie – oder Übermacht? – der neuzeitlichen Rationalität, also der Naturwissenschaften, immer noch nicht akzeptiert hat. Und so schlagen die einen vermutlich ob des wahnwitzigen „Heldentums der Priester“ und die anderen ob der „Realitätsverweigerung“ derer, die an physischen Gottesdienst festhalten, die Hände über dem Kopf zusammen.
 Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat auf die Frage, warum so viele trotz „des nicht näher zu bestimmenden Risikos“ die Ausübung von Freundes- und Liebesbeziehungen als potentiell gefahrvoll bestimmen, und deshalb einstellen, auf den katholischen Priester Ivan Illich verwiesen. Der hatte schon in den 1970er Jahren7 auf die Problematik einer technokratisierten Medizinindustrie und Medikalisierung menschlicher Existenz hingewiesen: Wer die Definition des Lebens einer naturwissenschaftlichen Logik unterwirft, unterliegt der Gefahr die affektiven und kulturellen Komponenten des Lebens vom übermächtigen biologischen Lebensbegriff abzuspalten.8 In letzter Instanz werden so Erfahrungen von Gesundheit, Krankheit und Tod dem biologischen Leben, man könnte auch sagen: dem „nackten Leben“ zugerechnet. Affektivität, Konvivialität, Nähe und Zärtlichkeit stehen dem „nackten Leben“ dann unvermittelt gegenüber, so dass ein dualistisches Verständnis des Lebens konstruiert wird.
Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat auf die Frage, warum so viele trotz „des nicht näher zu bestimmenden Risikos“ die Ausübung von Freundes- und Liebesbeziehungen als potentiell gefahrvoll bestimmen, und deshalb einstellen, auf den katholischen Priester Ivan Illich verwiesen. Der hatte schon in den 1970er Jahren7 auf die Problematik einer technokratisierten Medizinindustrie und Medikalisierung menschlicher Existenz hingewiesen: Wer die Definition des Lebens einer naturwissenschaftlichen Logik unterwirft, unterliegt der Gefahr die affektiven und kulturellen Komponenten des Lebens vom übermächtigen biologischen Lebensbegriff abzuspalten.8 In letzter Instanz werden so Erfahrungen von Gesundheit, Krankheit und Tod dem biologischen Leben, man könnte auch sagen: dem „nackten Leben“ zugerechnet. Affektivität, Konvivialität, Nähe und Zärtlichkeit stehen dem „nackten Leben“ dann unvermittelt gegenüber, so dass ein dualistisches Verständnis des Lebens konstruiert wird.
Nun muss man nicht jedem Konservativen eine Sensibilität für die Ganzheitlichkeit des Lebens unterstellen. Oft genug ist es auch nur das Festhalten an Tradition oder das unbegriffene Gespür für den Kältestrom der Moderne und des Kapitalismus, der uns mit uns im Moment größter Not alleine lässt. Folgen wir an dieser Stelle lieber der italienischen Feministin und Kommunistin Silvia Federici9, die von Enthaltsamkeit und Abstinenz als letztem Schritt von einem langen Prozess des Kapitals spricht. Dieser Prozess nimmt uns den sinnlich-sexuellen Inhalt unseres Lebens und unserer Begegnung mit anderen Menschen. Die physische Berührung, so schreibt sie, wurde durch das Bild vor dem geistigen Auge ersetzt. Größer kann der Widerspruch zu den biblischen Heilungs- und Krankheitsgeschichten wohl kaum noch sein: Das Wissen um die Berührung, die Nähe, also auch die Compassion als heilende, als einbeziehende und tröstende Kraft scheint dort, wo es doch eigentlich seinen selbstverständlichen Ort haben sollte, in den christlichen Kirchen und Gemeinschaften, heimatlos geworden zu sein. Das Bild des hl. Franziskus von Assisi, der durch die zärtliche Berührung eines Leprakranken Christus selbst begegnet und sein Leben radikal verändert, wirkt da unwirklich aus der Zeit gefallen.
Dass die Entfremdung von der sinnlichen Begegnung menschlicher Körper, von der Berührung durch den anderen heute und besonders in Zeiten der Pandemie ihre eigenen brutalen Folgen zeitigt, berichtet der italienische Philosoph und Medientheoretiker Bifo Gerardi: „Ein befreundeter Psychiater sagte mir, dass viele Menschen, die Hilfe brauchen, in diesen Tagen anrufen. Die überwiegende Mehrheit von ihnen ist jung oder sehr jung. In dem Gebiet, in dem meine Freundin arbeitet, hat sich die Zahl der Selbstmorde (alle oder fast alle in jungen Jahren) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergangenheit fast verdreifacht. Panikattacken sind weit verbreitet. Klaustrophobie wechselt sich ab mit Agoraphobie, dem Schrecken, aus dem Haus gehen zu müssen, um wieder in die Welt hinauszugehen, wo ein unsichtbarer Feind lebendig wird.“10
Wir müssten wieder zu einem Standpunkt gelangen, der uns von der vermeintlichen, weil rein instrumentell gedachten Vernunft11, der Plausibilität gesellschaftlichen und staatlichen Handelns in der Pandemie löst. Wir müssen uns von den Schreckensbildern und ihren Fantasmen befreien und einen Umgang mit der Pandemie finden, der Leben nicht auf bloßes Überleben reduziert und und uns nichtin Ohnmacht und Angststarre verfallen lässt. Dies wird uns nicht einfach individuell möglich sein, das „kann nicht jede/r für sich selbst entscheiden“ gerade weil es um etwas geht, das zwischen uns, dort wo wir uns berühren und begegnen, mit unsren Leben und unseren Körpern, geschieht. Die Notwendigkeit von Vergemeinschaftung wie Vergesellschaftung war selten so drängend, wie in den Zeiten der Pandemie und selten haben wir so deutlich gespürt, dass die Kirchen dazu keinen Beitrag mehr leisten, es vielleicht gar nicht mehr tun wollen.
Sie haben sich stattdessen den gesellschaftlichen Plausibilitäten, den staatlichen Verordnungen unterworfen, ihre Gottesdienste ausgesetzt und Beerdigungen, Trauerfeiern und Freudenfeste verschoben. Als ob man Trauer und Freude verschieben könnte! Als ob die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach kollektiver Deutung der Welt, nach Symbolen und rituellen Praktiken ein Luxus wäre, der in guten Zeiten dazugehört und auf den man eben mal verzichtet, wenn die Zeiten schwieriger werden.
„Mit dem jetzt bestehenden Gottesdienstverbot handelt die Kirche in Deutschland – bei allem Verständnis für die Feier der Eucharistie – vernünftig und verantwortungsvoll“12, so die Deutsche Bischofskonferenz am 07. April 2020.
Es gab übrigens in den allgegenwärtigen Coronaschutzverordnungen das pikante Detail, dass den Kirchen keine Schließungen aufoktroyiert waren, sondern sie freiwillig zugestimmt hatten. Auf diese Weise wollte man sicherlich beiderseits einer unschönen Auseinandersetzung um die Religionsfreiheit entgehen. So hieß es in der Verordnung von NRW vom März 2020 unter § 11: (3) Versammlungen zur Religionsausübung unterbleiben; Kirchen, Islam-Verbände und jüdische Verbände haben entsprechende Erklärungen abgegeben. Ansonsten ist bsw. im Blick auf andere Veranstaltungen, Geschäftstätigkeiten etc. immer von „Untersagungen“ die Rede.13 Auch als Ende April dann Gottesdienste in gewissem Umfang erlaubt waren, gaben sich die Kirchenfürsten alle Mühe, auch nicht im Ansatz den Anschein einer dissidenten Position in der Hygienepolitik zu erwecken.14
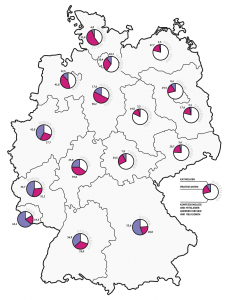
Die Kirche wollte „vernünftig“ sein und hat einer Unvernunft Vorschub geleistet, die nicht mehr das Ganze der Wirklichkeit zu begreifen sucht, sondern sich an den herrschenden Plausibiliäten orientiert. Sie hat noch den Rest von Ungleichzeitigkeit aufgegeben, der in ihrem Bewusstsein von der Gottesebenbildlichkeit der Menschen steckt und das Leben unter dem Vorwand, es zu schützen, banalisiert. Sie wollte in der Pandemie überleben und hat das eigene Sterben vorangebracht, indem sie sich für überflüssig erklärt und selbst überflüssig gemacht hat. Das es auch anders ginge, belegen viele – leider – kleine Beispiele von Gemeinden, die ihre Kirchen als Orte der Begegnung offen gehalten haben und persönliche, seelsorgerliche Angebote jenseits von zoom und youtube entwickelt haben, die an Gemeinschaft und Solidarität auch in Zeiten der Pandemie festhielten und gerade darin verantwortlich und vernünftig zugleich gehandelt haben.
Die Unterwerfung unter den Verlust der Demokratie
Die Zeit des Virus hat trotz ihrer offenbarenden Kraft, mit der die gesellschaftlichen Widersprüche zutage traten, die politische und moralische Urteilskraft nicht zu neuen Höhen getrieben: „Die Kombination von monokausalen Narrativen, inklusive virologisch basierter Datenhoheit, konstruiert ein «Zeitalter der totalen Gewissheit», die zum fast vollständigen Wegfall klassischer Urteilskraft gegenüber Richtig und Falsch führt.“15 Und wieder ist es der Italiener Agamben, der die dazugehörige Frage stellte: „Ich möchte mit denjenigen, die Lust dazu haben, eine Frage teilen, über die ich seit einem Monat unablässig nachdenke. Wie konnte es geschehen, dass ein ganzes Land im Angesicht einer Krankheit ethisch und politisch zusammenbrach, ohne dass man dies bemerkte?“16
Was man vor allem, neben der sicherlich aufrichtigen Angst vieler um das Leben der Menschen, nicht bemerkte, war, dass es darum ging, die „Gesellschaftsmaschine“ am Laufen zu halten. Dass es darum ging, einen „Gemeinsinn der Superlative“ hervorzubringen, in dem die Restriktionen als höchste Form des Altruismus erscheinen sollten, um dem am Horizont dunkel leuchtenden „worst case“ begegnen zu können.17 Der „worst case“ wurde in einem Strategiepapier des bundesdeutschen Innenministeriums so beschrieben: „Die deutsche Volkswirtschaft ist eine Hochleistungsmaschine, die Jahr um Jahr ein hohes Maß an materiellem Wohlstand und allen Bürgern zugänglichen öffentlichen Gütern wie einer umfassenden Gesundheitsversorgung und öffentlicher Sicherheit bereitstellt. … Sollten die … Maßnahmen zur Eindämmung und Kontrolle der Covid-19-Epidemie nicht greifen, könnte im Sinne einer ›Kernschmelze‹ das gesamte System in Frage gestellt werden. Es droht, dass dies die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur Anarchie verändert.“18
Wundert uns nun die inflationäre und verkehrte Verwendung des Begriffs des Ausnahmezustands, der den Grund dafür liefert, dass „Verantwortlichkeit in Zeiten von Corona“ nichts anderes als die Pflicht zur Gesundheit ist und Altruismus und Solidarität mit „social distancing“ gleichgesetzt werden? Im Alltagsdiskurs wird der Begriff des Ausnahmezustandes häufig mit einer „Notsituation“, einer außergewöhnlichen Gefährdungssituation, konnotiert. Aber der Ausnahmezustand ist etwas ganz anderes. Der „Ausnahmezustand“ verweist im engeren Sinne auf die Aussetzung des Rechts, er beschreibt dessen Aufhebung und damit die der Demokratie. In diesem Sinne ist die Nutzung des Begriffs des Ausnahmezustandes nach der politischen Theorie des faschistischen Staatsrechtlers Carl Schmitt momentan nur eine Analogie. Aber tatsächlich ist es so, dass die Einsetzung des Infektionsschutzgesetzes einer weitgehenden Aussetzung des Rechts gleichkommt. Denn es erlaubt eben das Regierungshandeln auf Basis von Verordnungen, Erlassen und Allgemeinverfügungen: Ausgangssperren, Versammlungsverbote etc. wurden nicht auf der Basis parlamentarischer Legitimation verkündet, sondern von Krisenstäben und Arbeitsgruppen und werden häufig mit Verweis auf die andauernde „Ausnahmesituation“ verlängert, ja ihre Fortdauer auch damit begründet, dass sonst die Ausnahmesituationen (Infektionsraten, steigende R-Zahlen, Überlastung des Gesundheitssystems etc.) fortdauern könnten.19
Die Aussetzung der Demokratie im Regelwerk der Verordnungen war eine Konsequenz der Corona-Pandemie, die zu akzeptieren den Kirchen vielleicht besonders einfach gefallen ist, weil sie sich ja traditionell schon immer schwer mit der Demokratie getan haben. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass sie sich in den Zeiten nach dem Faschismus zunächst der formierten Gesellschaft des „rheinischen Kapitalismus“, später dann auch seinen liberaleren Varianten angedient haben. Ihre fehlende Sensibilität für Grenzen und Gefährdungen der Demokratie können niemanden verwundern, der um die Geringschätzung der Demokratie in den Kirchen selber weiß. Das gilt übrigens für beide Großkirchen, auch wenn es sich in je unterschiedlicher Weise ausformt. Wo die römisch-katholische Kirche schon formalen Repräsentationsfiguren der Demokratie feindlich entgegensteht, ist vielen evangelischen Kirchen zwar eine solche formale demokratische Struktur eigen, hinter der sich dann aber oft genug doch Erhebliches an hierarchischen und intransparenten Strukturen verbirgt. Wie auch immer, es gäbe gerade gegenwärtig genug Gründe, einer repräsentativen Demokratie gegenüber kritisch zu sein. Ihrer Aussetzung allerdings schweigend beizuwohnen, verweist auf ein Maß an Anpassung, das der Notwendigkeit einer Neuerfindung der Demokratie angesichts der katastrophalen Zustände der Welt diametral entgegensteht. Wenn wir uns als ChristInnen so verhalten, als ob uns die Politik als Ausdruck gesellschaftlicher Ausgestaltung unseres Zusammenlebens – die polis oder der oikos – nichts angehen, dann scheint es, als ob wir unsere Wurzeln in der Geschichte des Exodus, die eine Geschichte von Autonomie und Freiheit ist, vergessen hätten.
Ekklesiologie der Unterwerfung
Die ganze Sprachlosigkeit der Kirchen angesichts der Pandemie lässt sich nicht anders als eine Ekklesiologie der Unterwerfung beschreiben. Tatsächlich stellen sich die Kirchen immer noch nicht mit aller Schärfe jenem Phänomen, das Karl Rahner für die römisch-katholische Anfang der 1970er Jahre prognostiziert hatte: Dass sich nämlich die gesellschaftlichen Verhältnisse so ändern, dass es auch nicht mehr „zur bürgerlichen Wohlanständigkeit gehört, Taufscheinchrist zu sein, dass es gesellschaftlich nicht mehr deplaziert oder schädlich sein wird, standesamtlich aus der Kirche auszutreten.“20 Rahners Sorge bestand noch darin, dass sich die katholische Kirche dagegen durch Rückzug auf traditionelle Theologie, Liturgie und Lebensstil immunisieren würde, um sich so der eigentlichen Herausforderung, als „Kirche der kleinen Herde“ in dieser Gesellschaft eine Zukunft zu entwickeln, zu entziehen. Heute ist diese Gefahr einer traditionalistischen Sektenmentalität nur noch am Rande wirksam und zeigt sich vielleicht im Strukturkonservatismus bezüglich klerikaler Kirchenhierarchie noch am deutlichsten. Im Allgemeinen hat sich wohl eher eine Anpassungsermüdung an die gesellschaftlichen Verhältnisse breitgemacht, eine Gleichzeitigkeit mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich nach Innen maximal in gewissen Modernisierungsbestrebungen (Pfarreireformen etc.) und nach Außen in der Bescheidung auf Kontingenzbewältigungspraxis zufrieden gibt oder sie aufwändig theologisch und praktisch auch noch zu überhöhen sucht. Die Anpassung an den Kapitalismus, die stumme Verbeugung vor instrumenteller Vernunft und der Aussetzung der Demokratie verweist aber viel dramatischer auf eine Ekklesiologie der Unterwerfung, wie sie vielleicht zuletzt die frühe Kirche im Übergang zur konstantinischen Wende – allerdings ganz anders aus einer Position der zunehmenden Stärke – geprägt hat. Eine solche Ekklesiologie allerdings dürfte heute im 21. Jahrhundert nicht wieder zum damaligen frühchristlichen Phyrrussieg der imperialen Christenheit21 reichen: das eigene Überleben und den institutionellen Fortbestand mit aller Härte bedingungslos abzusichern, auch um den Preis des Verrats an der eigenen Widerstands- und Verfolgungsgeschichte.
Kurz nach der Würzburger Synode der bundesdeutschen katholischen Kirche Anfang der 1970er Jahre schrieb Johann Baptist Metz noch: „Kirche muss sich verstehen und bewähren als öffentliche Zeugin und Tradentin einer gefährlichen Freiheitserinnerung in den ‚Systemen‘ unserer emanzipatorischen Gesellschaft.“22 Die Würzburger Synode atmete noch den Geist einer optimistischen Aufbruchsbewegung und war die Suchbewegung auf einen neuen Ort in der Welt hin. Die innerkirchliche Reaktion unter der Glaubenskongregation und dem späteren Papst Ratzinger eröffnete daraufhin die Konfrontation mit den ErneuerInnen, weil sie die Befürchtung hatten, das mit so einer Bewegung eine Anpassung an die bürgerliche Moderne vorangetrieben werden würde, der die Kirche wenig entgegenzusetzen hatte. Sie ahnten nicht, dass ihre Angst sich weniger auf die die Anpassungsfähigkeit an die bürgerliche Gesellschaft hätte fokussieren sollen, als vielmehr auf die Anpassungsschwierigkeiten der Kirche an ihre eigenen Traditionen und ihre eigene Herkunft. Sie ahnten also nicht, wie hoffnungslos Recht sie behalten sollten. Und natürlich noch weniger, wie sehr sie in ihrer repressiven, phantasielosen und alle gegenläufigen Versuche diffamierenden Politik Anteil an dieser Hoffnungslosigkeit haben sollten. Die Anpassungsschwierigkeit traf auch den bürgerlichen, vermeintlich aufgeklärten Teil der Kirche. Die Würzburger Synode ahnte schon diese von der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer kapitalistischen Ausformung drohende Gefahr: „Die Krise des kirchlichen Lebens beruht letztlich nicht auf Anpassungsschwierigkeiten gegenüber unserem modernen Leben und Lebensgefühl, sondern auf Anpassungsschwierigkeiten gegenüber dem, in dem unsere Hoffnung wurzelt und aus dessen Sein sie ihre Höhe und Tiefe, ihren Weg und ihre Zukunft empfängt.“23
 Die Tragik des Umgangs der Kirche mit der Pandemie zeigt sich vielleicht an jenem folgenden Satz der politischen Theologie nur zu genau, wenn man ihn mit den gegenwärtigen Bildern vereinzelter und alleine in den Kirchenbänken sitzenden Gläubigen zusammen liest, die die Eucharistie (eucharistia der Praxis als „‘Materie‚ des anbrechenden Reiches Gottes“24 ) aus den latexbehandschuhten Händen des Priesters entgegennehmen: „.. die Vorstellung einer völlig institutionsfreien kirchenlosen Überlieferung dieses Gedächtnisses, die den privaten Einzelnen zum ausschließlichen Erinnerungsträger macht, erscheint illusionär.“25 Den Gemeinden fällt es zunehmend schwer, eine Kirche zu verstehen, deren „Sein für das Reich“ verschwindet, und die sich nur noch von ihrer Institutionalität her versteht. So beschrieb der chilenische Befreiungstheologe Fernando Castillo26 in den 1980er Jahren die Situation der ChristInnen in Chile. Auch bei uns sind es immer mehr, die nicht verstehen wollen, dass die Kirche sich nur noch von ihrer (Rest-)Institutionalität her versteht. Aber statt darüber nachzudenken, wie die Überlieferung der christlichen Botschaft in dieser Welt als „unabgegoltene und gefährliche Erinnerung wachgehalten werden kann,“27 unterwerfen sich die Restbestände der Kirche (und der Theologie) unter die herrschenden Verhältnisse in einer dann doch wieder „kleinhäuslerischen Sektenmentalität“28 in der Hoffnung – wider alle Vernunft – das Virus und diese kapitalistisch-bürgerliche Welt überleben zu können.
Die Tragik des Umgangs der Kirche mit der Pandemie zeigt sich vielleicht an jenem folgenden Satz der politischen Theologie nur zu genau, wenn man ihn mit den gegenwärtigen Bildern vereinzelter und alleine in den Kirchenbänken sitzenden Gläubigen zusammen liest, die die Eucharistie (eucharistia der Praxis als „‘Materie‚ des anbrechenden Reiches Gottes“24 ) aus den latexbehandschuhten Händen des Priesters entgegennehmen: „.. die Vorstellung einer völlig institutionsfreien kirchenlosen Überlieferung dieses Gedächtnisses, die den privaten Einzelnen zum ausschließlichen Erinnerungsträger macht, erscheint illusionär.“25 Den Gemeinden fällt es zunehmend schwer, eine Kirche zu verstehen, deren „Sein für das Reich“ verschwindet, und die sich nur noch von ihrer Institutionalität her versteht. So beschrieb der chilenische Befreiungstheologe Fernando Castillo26 in den 1980er Jahren die Situation der ChristInnen in Chile. Auch bei uns sind es immer mehr, die nicht verstehen wollen, dass die Kirche sich nur noch von ihrer (Rest-)Institutionalität her versteht. Aber statt darüber nachzudenken, wie die Überlieferung der christlichen Botschaft in dieser Welt als „unabgegoltene und gefährliche Erinnerung wachgehalten werden kann,“27 unterwerfen sich die Restbestände der Kirche (und der Theologie) unter die herrschenden Verhältnisse in einer dann doch wieder „kleinhäuslerischen Sektenmentalität“28 in der Hoffnung – wider alle Vernunft – das Virus und diese kapitalistisch-bürgerliche Welt überleben zu können.
Das Ende des Symbolischen
Der Rückzug der Kirchen in Zeiten von Corona betraf nicht einfach alle ihre Vollzüge in gleicher Form, sondern äußerte sich vornehmlich und zuerst in der liturgischen Praxis als einer symbolischen. In anderen Bereichen wie z.B. den caritativen und diakonischen der Altenversorgung, den Krankenhäusern oder Pflegeheimen ging die Arbeit weiter. Natürlich unter den gleichen elendigen Bedingungen wie in allen Einrichtungen: unzureichende Schutzkleidung, keine Testkapazitäten etc. Von einer Altenpflegerin hörten wir, dass der zuständige Seelsorger sich auch hier aus der gottesdienstlichen und seelsorgerlichen Arbeit zurückgezogen hatte. Offenkundig spielte für die Kirchen die symbolische Ordnung in ihren liturgischen Ausdrucksformen und die Verkündigung im Zusammenhang von Gemeindeleben kaum eine Rolle mehr. Dabei ist es aber nicht so, dass gesamtgesellschaftlich die Suche nach symbolischen Vermittlungen von Leben und Sinn aufgegeben sind. Aber sie sind zunehmend aus den Kirchen ausgezogen und entinstitutionalisieren sich. Und die Kirchen scheinen davor resigniert zu haben.29 Sie haben gewissermaßen ihre symbolische, bzw. ideologische Praxis aufgegeben, in der in der Regel das Weltverhältnis der Menschen aus ihrer eigenen Tradition, Geschichte und Institution (und nicht zuletzt deren Kontinuität) thematisiert wird. Die symbolische Ordnung ist ebenso wie die ökonomische oder politische Ordnung Ort der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Existenzbedingungen, sie ist „eine materielle Kraft, die über Codes, Riten und Institutionen“30 Teil der Welt ist. Die sakramentale Praxis de Eucharistie wäre insofern symbolische, ideologische Praxis: Die eucharistische Feier verweist auf die Notwendigkeit und Verpflichtung auf „reales Teilen, also auf globale Gerechtigkeit. Die Eucharistie ist, obwohl symbolische Praxis, zugleich aber auch materiell. Sie braucht die reale Gemeinschaft der Gläubigen, das gemeinsame Gebet (die Erinnerung an das letzte Abendmahl). In ihrer institutionalisierten Feier transportiert und tradiert sie zugleich das subversive Gedächtnis, die gefährliche Erinnerung an die jesuanische Praxis. Wir können auf die reale Zusammenkunft der Gemeinde und die symbolische und sakramentale Feier und Erinnerung unserer Traditionen nur um den Preis der Banalisierung des Christentums verzichten: „Aus dem Gebet (der Feier, der Lektüre, dem Lied, A. d. AutorInnen ) … die Freiheit von den vermeintlichen Plausibilitäten der sozialen Mechanismen und Vorurteile zu gewinnen und die Kraft zu jener Selbstlosigkeit, die ein Handeln im Interesse der anderen, der Geringsten unter den Brüdern (und Schwestern, A. d. AutorInnen)‘ erfordert“31, ist der tiefe materielle und symbolische Sinn liturgischer Zusammenkunft.
Die Praxis der Hoffnung auf Heil für alle in der spezifischen Vermittlung durch Texte, Erzählungen und Liturgie (also in symbolischer und theoretischer Praxis) wäre „messianische Religion“, eine Religion, die sich aus Erinnerung speist und durch Erinnerung lebt. Sie ist also dort, wo sie lebendig ist, eingebettet in einen Tradierungszusammenhang, in die Gemeinschaft der Glaubenden und ihrer Verbindlichkeit erzwingenden Erinnerung. Das Ende der Tradition, so sagte Adorno, ist der Einmarsch in die Unmenschlichkeit. Die Kirchen haben diese Einsicht gedankenlos aufgegeben, und stattdessen kontaktlose Weihwasserspender  beworben und youtube-clips produziert und produzieren lassen. Sie haben ihre eigne symbolische Ordnung aufgegeben, Heil in der digitalen Vermittlung ihrer Heilsbotschaft gesucht und damit die materielle Ebene der symbolischen Vermittlung entwichtet. Der einsame, gummibehandschuhte katholische Priester im Vollzug der Eucharistiefeier im youtube-Kanal erinnert an den vorkonziliaren Eucharistievollzug mit dem Rücken zu den Menschen.
beworben und youtube-clips produziert und produzieren lassen. Sie haben ihre eigne symbolische Ordnung aufgegeben, Heil in der digitalen Vermittlung ihrer Heilsbotschaft gesucht und damit die materielle Ebene der symbolischen Vermittlung entwichtet. Der einsame, gummibehandschuhte katholische Priester im Vollzug der Eucharistiefeier im youtube-Kanal erinnert an den vorkonziliaren Eucharistievollzug mit dem Rücken zu den Menschen.
Diese Fluchtbewegungen, die sozusagen das religiöse Gegenstück zum Peloton sind (das workout mit digitalem Personaltrainer), zeugen zugleich vom Unverständnis der herrschenden symbolischen Ordnung. Offenkundig glauben die Kirchen in ihrem Coronakrisenmanagement tatsächlich, durch eine Adaption der Instrumente des herrschenden Coronaregimes (homeoffice und Digitalisierung) durch die Zeit kommen zu können. Das aber die herrschenden Methoden Teil einer gesellschaftlichen Praxis im Blick auf Individualisierung, Selbstmanagement und Digitalisierung sind, bleibt ihrem Blick versperrt. Was für die gegebenen Verhältnisse funktional sein mag, kann sich für eine christliche (symbolische) Praxis verheerend auswirken: Social Distancing und Maskenpflicht spannen uns in tiefes Misstrauen gegen die Anderen ein und sind keineswegs Zeichen der sorgenden Fürsorge. Die Berührung wird überflüssig, und unser Antlitz erreicht den Anderen hinter der Maske nicht mehr. Mitten in der Öffentlichkeit verschwinden wir füreinander selbst in unserer liturgischen Praxis und machen Platz für eine Desozialisierung, eine Entkörperlichung und Entmaterialisierung des Lebens, für Resilienz und Selbstkontrolle.32
Den Kirchen wäre es wie keiner anderen gesellschaftlichen Kraft möglich gewesen, aus den Ressourcen ihrer eigenen Traditionen Symbole und Erzählungen zu aktivieren, die geeignet sind an einer Überwindung der Angst mitzuwirken, die aus den vereinzelten, verunsicherten Individuen, eine Gemeinde machen. Eine solche Gemeinde wäre von dem Bewusstsein erfüllt, die widerständige Botschaft jener Jesusbewegung weiterzutragen, die sich der Ungerechtigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse genauso in den Weg stellte, wie sie Kranke aus ihrer sozialen Isolation befreite und von Dämonen besessene aufrichtete. Denn diese Bewegung wüsste davon, dass diese Praxen miteinander in Verbindung stehen. Ausgestattet mit einem Glauben, der sogar die Letztgültigkeit des Todes infrage zu stellen vermag, besitzt das Christentum eine tiefe symbolische Kraft, die sich der Hoffnungslosigkeit entgegenstellen kann und die dialektische Möglichkeit besitzt, um das nackte Leben eines jeden und einer jeden zu kämpfen. Denn das Christentum weiß ja gerade um die Notwendigkeit eines guten Lebens für alle, eines Lebens in Fülle, das sich vom bloßen Überleben unterscheidet. Dass die Kirchen von all dem nicht gesprochen haben, geschweige denn dafür eine den Zeiten entsprechende symbolische und gemeinschaftliche Praxis gefunden haben, ist vielleicht die bitterste Erkenntnis im Sinne des Zustandes der christlichen Traditionen, die uns Corona beschert hat. Es braucht aber die Erkenntnis dieses tiefen Scheiterns, wenn wir darüber ein Bewusstsein gewinnen wollen, was alles möglich ist, wenn wir ungleichzeitig an einem messianischen Christentum festhalten wollen. Und was vielleicht mit einem solchen Christentum endgültig aus dieser Welt verschwinden könnte.
Angst und Verantwortung
Mit der Aufgabe ihrer eigenen symbolischen Ordnung und mit der Kapitulation davor, die symbolische Ordnung der Welt, die uns die Corona-Pandemie offenbarte und in die sie uns stürzte, zu verstehen zu versuchen, hatten die Kirchen der Angst der Menschen vor Krankheit und Tod nichts mehr entgegenzusetzen. Sie wusste jedenfalls nichts anderes zu tun, als sich bedingungslos an alle vorgeschlagenen Vorsichtsmaßnahmen zu halten und darin die höchste Form der Nächstenliebe zu erblicken, wie es in vielen Predigten landauf, landab verkündet wurde. Wer seinen Nächsten liebt, der meide ihn also. Die Trauer, den Schmerz der Isolation, das Vermissen von Zärtlichkeiten, von der körperlicher Berührung sollten die Gläubigen sowie die anderen braven StaatsbürgerInnen bereitwillig akzeptieren als jenen Preis, den es für das eigene Überleben zu zahlen gelte. Die Angst ging dabei soweit, dass sie selber ein brutales Gesicht zeigte, in der stummen Brutalität, mit der man die Alten und Kranken isolierte, auch gegen ihren Willen, die Sterbenden allein ließ und auch ohne Protest oder zumindest Skepsis der Kirche die Trauerrituale einzuschränken oder zu verschieben suchte. Nicht nur die lebenden, auch die toten Körper waren vor allem Objekte der Gefahr. Und auch die Kirchen gaben als eine der letzten gesellschaftlichen Instanzen ihren jahrhundertelangen Respekt vor dem toten Körper (zugegebenermaßen hatten sie sich mit dem Respekt vor den lebendigen Körpern immer schon schwerer getan) ohne große Worte auch fast auf, indem sich auch hier der medizinische objektivierende Blick auf die Körper durchsetzte.
Auch die Kirchen unterwarfen sich dieser widersinnigen, pandemischen Logik: die Angst ließe sich nur überwinden, indem man sich die Sicherheit verschaffe durch das Einhalten von Regeln sein Bestmögliches getan zu haben. Es müsse schon mit dem Teufel zugehen, wenn auch diejenigen erkrankten und stürben, die doch immer alles richtig gemacht haben. Die Kirchen haben gar nicht gemerkt, wie sie da ein säkulares Sündenverständnis übernommen haben, das den neoliberalen Gesundheitsdiskurs zutiefst prägt: Es ist eine hehre moralische Pflicht auf die eigene Gesundheit zu achten und andere dazu anzuhalten: Vorsorgeuntersuchungen, Wellness, Sport, Körperpflege, gesunde Ernährung – all das sind Maßnahmen, mit denen die Einzelnen verpflichtet sind, „etwas für ihre Gesundheit zu tun“, ihre Körper fit und leistungsfähig zu halten. Wer dies nicht tut, ist selber schuld, an Krankheit oder körperlichem Verfall, weil er seine Pflichten sträflich vernachlässigt hat. Diese Logik galt auch in Zeiten von Corona. Im beschwörenden Gruß „Bleib/Bleiben Sie gesund“ lag auch ein moralischer Imperativ: Halten Sie sich an die Regeln, halten Sie Abstand, bleiben Sie zu Hause, tun sie etwas, nein, am besten alles, um gesund zu bleiben. Für diesen moralischen Druck, der mit Selbstgerechtigkeit, mit dem Irrglauben, anständiges Verhalten könne uns Sicherheit verleihen einherging, für die allgegenwärtige Kontrolle und Unterwerfung durch einen säkularisierten Schulddiskurs haben die Kirchen ebenfalls jegliche Sensibilität vermissen lassen. Ja, die überwältigende Mehrheit ihrer Mitglieder wie FunktionärInnen hat ihn völlig unkritisch übernommen und in eine christliche Sprache der Nächstenliebe, des Opfers und der Verantwortung gekleidet. Dabei haben sie vergessen, wie sehr der Jesus der Evangelien darauf insistierte, den Zusammenhang von Schuld und Krankheit zu durchbrechen: Die Kranken, die Armen, die Verelendeten sind nicht selber schuld, vielmehr soll sich an ihnen „die Herrlichkeit Gottes erweisen“, indem sie zu Subjekten werden, zu Subjekten ihrer eigenen Befreiung wie der Befreiung aller. Zum Subjekt zu werden schließt die Verantwortung für das Leben und die Subjektwerdung der Anderen mit ein. Es ist aber einse Subjektwerdung, die Angst und Ohnmacht überwindet. Es geht aufs Ganze und für alle nicht um die Illusion der Schuldlosigkeit, nicht um organisierte Verantwortungslosigkeit, aber eben auch nicht um individualisiertes Schuldbewusstsein, sondern um die Möglichkeit die Schuld zu überwinden, die uns niederdrückt und kleinhält, auch auf die Gefahr hin sich im Zuge ihrer Überwindung die Hände schmutzig zu machen, schuldig zu werden, zu scheitern. In der Corona-Pandemie hätte das ein Vielfaches bedeuten können: eben nicht ängstlich, sondern mutig Verantwortung zu übernehmen, indem wir als ChristInnen die gesellschaftlichen Widersprüche, die die Pandemie sichtbar gemacht hat, aufdecken, an einer messianischen widerständigen Gegenpraxis arbeiten und dabei aus unseren Traditionen schöpfen. Zu dieser Gegenpraxis gehört die praktische Solidarität, mit denen, die unter der Pandemie leiden ebenso wie eine scharfe Analyse der sich besonders deutlich offenbarenden Verhältnisse. Wer redet zum Beispiel heute noch von den menshengemachten Ursachen, die so gehäuft zu Epidemien und Pandemien führen? Zu so einerGegenpraxis gehören auch das prophetische Aufstehen gegen Unrecht und Ungerechtigkeiten in der Öffentlichkeit ebenso wie das Festhalten an einer symbolischen Ordnung, die ein Jenseits des technokratischen Paradigmas deutlich macht und deshalb auf Rituale, Trauer, Körperlichkeit, Begegnung, Berührung, Feier und Fest nicht verzichten kann. Leider haben zu einer solchen Praxis die Kirchen kaum einen Beitrag geleistet. Nun ist es also an uns dies weiter zu tun, das Leben in Fülle sichtbar werden zu lassen und gemeinsam zu erkämpfen, auch und gerade in Zeiten der Pandemie, der Angst zum Trotz.