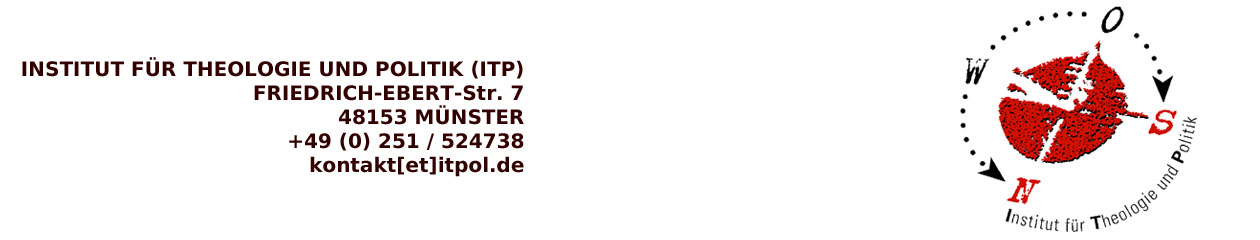Am 16. November 1989 wurden in der Katholischen Universität (UCA) in San Salvador sechs Mitglieder der dort lebenden Jesuitengemeinschaft, die Köchin und deren Tochter vom Militär ermordet. Unter den Ermordeten war der Rektor der Universität, der Theologe und Philosoph Ignacio Ellacuría. Ein Mitglied der Gemeinschaft, der Theologe Jon Sobrino, hielt sich zu der Zeit im Ausland auf und entging so dem Anschlag. Seit 1989 veröffentlicht Jon Sobrino jeweils zum Jahrestag des Massakers einen Brief an seinen ermordeten Freund Ellacu, Ignacio Ellacuría. In den Briefen – die von 1989 bis 2004 sind inzwischen auf Spanisch als Buch erschienen, eine deutsche Übersetzung ist in Vorbereitung – greift er aktuelle theologische und politische Fragen auf. Im Brief von 2006, den wir hier auszugsweise zitieren, schreibt er über die im Mai 2007 bevorstehende V. Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe (CELAM) in Aparecida. Er benennt Erwartungen, Hoffnungen und Schwierigkeiten. Dabei blickt er auch zurück auf die Erfahrungen der vergangenen drei Generalversammlungen: 1968 in Medellín und 1979 in Puebla – beide hatte Ignacio Ellacuría kritisch begleitet – und 1992 in Santo Domingo.
Brief an Ignacio Ellacuría SJ
Aparecida: Wir hoffen auf eine Versammlung und ein Dokument „mit Geist“
27. Oktober 2006
Lieber Ellacu: Bald versammeln sich die Bischöfe in Aparecida. Gott allein weiß, was passiert. Eindeutig ist, wir müssen „der Geschichte eine andere Wendung geben“. Das hast Du bereits bei deiner letzten Rede in Barcelona zehn Tage vor deinem Tod gesagt. Zweifellos müssen wir der Geschichte des Kontinents, und weitgehend auch der Geschichte der Kirche eine andere Wendung geben.
In Medellín 1968 spürte man etwas von Gott. Dafür warst du dankbar; das hat dich unter uns Jesuiten und auf der Linie der Spiritualität von Ignatius, und in der UCA, unserer Universität, und im Land sehr produktiv gemacht. Schon bald folgte die Reaktion, denn ein Gott der Unterdrückten stört. Das Weiße Haus reagierte mit dem ‚Rockefeller-Bericht’. Auch einige CELAM-Mitglieder reagierten. Leider setzte man – manchmal mit üblen Machenschaften – eine Kampagne von Angriffen gegen Bischöfe, Theologen, Ordensfrauen und Gemeinden in Gang.
In diesem Zusammenhang spürtest du sehr bald, dass Puebla Medellin stoppen sollte. Du hast das Vorbereitungsdokument für Puebla sehr genau analysiert, auf die positiven und negativen Aussagen hingewiesen. Besonders deutlich hast du darauf aufmerksam gemacht, dass die Zwiespältigkeit nicht überwunden werden könne, „wenn man Christologie und Ekklesiologie des Dokumentes nicht radikal umformuliert“. Daran denke ich gerade, weil diese Warnung immer noch nötig ist. Manchmal wird man das Gefühl nicht los, Jesus von Nazareth sei aus der lehramtlichen Christologie verschwunden. Von der „Kirche der Armen“ redet niemand mehr, von der „Kirche des einfachen Volkes“ ganz zu schweigen. Aber du hast nicht nur kritisiert, sondern einen brillanten Text beigesteuert: „Das gekreuzigte Volk. Ein Essay zur historischen Soteriologie“. Dieser Text hat zusammen mit den Predigten von Monseñor Romero Geschichte geschrieben. In den gekreuzigten Völkern sind Gott und sein Christus unter uns anwesend; von ihnen kommt das Heil. Du bliebst der Linie von Medellín treu und hast sie bereichert. Heute reden nur wenige so wie du.
Puebla konnte mit Medellín zwar nicht brechen, aber die Kirche wurde schon spürbar geschwächt. In Santo Domingo wurde dies dann offenkundig, wie man heute deutlich sehen kann. Santo Domingo wurde von Rom organisiert und kontrolliert. Unglaublich, dass das Dokument von Santo Domingo die Märtyrer ganz ignorierte und ihnen nicht für die größere Liebe dankte, die sie bezeugt haben. Darauf ist ja doch die ganze Kirche aufgebaut. Und die Armen in Santo Domingo wurden hinter hohen Mauern versteckt. Persönlich hatte ich das Gefühl, die Kirche schwankte hin und her zwischen der Furcht, Prestige zu verlieren, und dem Wunsch, Massen zu bewegen und Medienecho zu erzielen. Und trotz aller Feiern, Musik und Prozessionen nehme ich bis heute eine gewisse Orientierungslosigkeit, ja sogar Trauer in der Kirche wahr.
Als These formuliert: In Santo Domingo verwehrte man Medellín die Anerkennung als „unser Apostelkonzil von Jerusalem“. In Medellín hatte man entschieden, nicht mehr zu den Völkern, den Heiden zu gehen, sondern zu den Armen, sie zu begleiten und von ihnen zu lernen. In Santo Domingo spielte die Sache der Armen keine Rolle. Es sind Worte zur Inkulturation zu finden, für die Indígenas und Afroamerikanerinnen schon dankbar sind, so können nur die Armen reagieren, sogar dann, wenn wir sie nur halb oder spät in den Blick kommen. Das für mich Gravierendste war der Eindruck, die Kirche habe nichts mehr, worüber sie sich freuen kann. Weit weg war der Jubelruf des Paulus mitten in den Verfolgungen, die wir erlitten. Und nur wenig erinnerte an Jesu Jubelruf: „Ich preise dich Vater, weil du all das den Kleinen und Gedemütigten offenbart hast!“. Man spürte kaum etwas von der Freude der Gemeinden, ihren Wallfahrten und Gedenktagen an die Märtyrer, von der Solidarität, der „Zärtlichkeit der Völker“. … Ohne Freude aber kann eine Kirche, die sich auf eine guten Nachricht gründet, nicht gedeihen.
In Medellín übernahm die Kirche Verantwortung für die Geschichte und stellte sich ihr. Heute erweckt die Kirche – trotz einiger netter Worte in ihren Botschaften – nicht den Eindruck, sie hörte den „stummen Schrei von Millionen Menschen“ – von Unterdrückten, Frauen, Indígenas, AfroamerikanerInnen, EmigrantInnen, Jugendlichen, die weder wissen wohin noch was tun. Nichts erinnert mehr an die bekannten Worte vom Anfang des Kapitels über „die Armut der Kirche“ in den Texten von Medellín; nichts erinnert daran, dass ihre Grundoption sei, „die Gekreuzigten vom Kreuz zu holen“, wie du es formuliert hast, Ellacu.
Fast scheint es so, wir hätten die Richtung verloren. Wir greifen auch nicht unsere eigene Tradition auf: Dom Helder Camara, Don Leonidas Proaño, Don Sergio Mendez Arceo, Symbolgestalten für unsere heutige Kirche wie Las Casas und Valdivieso für ihre damalige. Anders als früher hören wir deswegen auch nicht viel von dem Satz, der dem genannten Text aus Medellín folgt: „die von ihren Hirten eine Befreiung erbitten, die ihnen von keiner Seite gewährt wird“. Bitten die Armen uns heute darum, dass wir sie befreien? Tragen wir ihre Geschichte mit?
Wenn wir die Redlichkeit und die Freude verschleudern, die Medellín hervorbrachte, ist der Rückfall in frühere Zeiten nicht zu vermeiden; und jeder weitere Tag lässt uns weiter zurückfallen. Die Aufgabe also ist nicht einfach, aber sie ist zu schultern. Auch in Aparecida kann Gott wieder eindringen, wie damals bei Monseñor Romero am Sarg von Rutilio Grande. Und dies kann auch uns allen geschehen, wenn auch vielleicht nur aus Scham. Einige Hoffnungszeichen sehe ich.
Es gibt Bischöfe, die der Meinung sind, dass wir dem übertriebenen Zentralismus nicht weiter folgen dürfen, mit dem wir die Realität unserer Gemeinden, ihre Freude und Trauer vernachlässigen. Das entspricht weder dem Evangelium, noch ist es menschenfreundlich oder löst Probleme. Wir müssen das ändern und die Gemeinden in den Blick nehmen.
Immer noch gibt es Leute, die an die unterirdischen Strömungen denken, die die Geschichte bewegen. Sie sprechen von Gott, der sich in Jesus gezeigt hat und der sich bei anderen Männern und Frauen Zuhause fühlt, die ihn längst vor der christlichen Epoche verehrt und geliebt haben. Sie sprechen vom Menschen und von dem, was ihn menschlich macht: Redlichkeit im Umgang mit der Realität, Compassion ohne Ausflüchte, Gerechtigkeit statt Unterdrückung, Gemeinschaft und Gemeinsamkeit statt isolierter Individuen, Gemeinsamkeit in der Hierarchie der Wahrheiten…
Es gibt Laien, Priester und Ordensschwestern, die mit aller Hoffnung weitermachen und sich allen möglichen Übeln widersetzen. Sie lassen sich nicht entmutigen, in ihnen lebt noch das, was man als ursprüngliche Heiligkeit bezeichnen könnte. Es ist beeindruckend, sie zu sehen, wie sie das Vorbereitungsdokument für Aparecida analysieren und Vorschläge entwickeln. Das Wichtigste ist jedoch, dass sie sich zusammentun und – mit oder ohne Vorbereitungsdokument – auf die Realität des einfachen Volkes, ihre Familien, ihre Pfarreien und auf sich selbst schauen und zu verstehen suchen. Sie schauen sich die Kirche genau an, um zu sehen, wie sie ist und wie sie sein sollte. Und dies sagen sie uns dann auch. Wenn auch nur im Kleinen, tun sie das, was dein größter Wunsch war, Ellacu: „Das Volk von El Salvador – insbesondere die Armen und Unterdrückten – sollen ihre Stimmen erheben“ – auch in der Kirche.
Wie wird Aparecida werden? Das weiß Gott allein. Hoffentlich entfesselt es in Menschen, Gruppen und Bischöfen kreative Dynamik. Aber momentan konzentrieren wir uns auf den Text, den die Bischofe schreiben sollen. Das Vorbereitungsdokument ist enttäuschend. Aber ein gutes Zeichen ist, dass gute und wichtige Vorschläge erarbeitet werden,um dies zu ändern. Die neuesten Ideen beziehen sich auf Gott in den verschiedenen Religionen, auf die Kirche in einer veränderten Welt, auf die Frau – ein für allemal – als Mensch, Christin, Amtsträgerin und aktives Mitglied der Kirche, auf die Ernennung von Bischöfen…
Die grundlegenden Themen (unglaublich, dass sie im Vorbereitungsdokument nicht zu finden sind) sind Jesus von Nazareth, das von ihm verkündete Reich Gottes und das von ihm bekämpfte Anti-Reich, das Wort der Schrift… Die dringlichsten Themen sind Leben, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit für die Mehrheiten… Und es gibt ein großes und liebevolles Bemühen, die Maria von Aparecida als zugleich lateinamerikanisches und christliches Symbol zu präsentieren, Antlitz der Armen des Kontinents und Antlitz Gottes.
Das Dokument von Aparecida müsste analytisch sein, gut analysiert – und hoffentlich holt man kompetente Menschen dazu, die die Bischöfe in Fragen der Bibel, der Theologie, der Pastoral und der Humanwissenschaften beraten können. Damit haben wir in der Vergangenheit bei vielen Konferenzen mit Beteiligung von Bischöfen gute Erfahrungen gemacht. Wir erinnern uns gut, wie du auf klare Analysen und Begriffe bestanden hast. Aber der Text braucht auch Geist. Dies ist auch etwas, das du uns hinterlassen hast: Um die „Materialität“ der Seligpreisungen bei Lukas und den „Geist“ in denen des Matthäus zusammenzubringen, hast du von den „Armen mit Geist“ geschrieben. Und in anderem Zusammenhang, auch wenn du die Idee einer lehramtlich konfessionell gebundenen UCA nicht attraktiv fandest, drängtest du darauf, dass die UCA eine Universität „mit Geist“ sein sollte. Deshalb definiertest du sie als Universität aus christlicher Inspiration: als „Vernunft mit Geist“.
Das ist es, was wir von Aparecida erwarten: „Texte mit Geist“. Einige werden fragen, was das sein soll. Darauf kann ich nur mit zwei Beispielen antworten. In der Predigt vom 10. Juni 1977 sagte Bischof Romero kurz und knapp: “Unsere Kirche wird unser leidendes Volk niemals sich selbst überlassen!” Die einfachen Leute begriffen sofort, was er sagen wollte und welcher Geist ihn erfüllte. Aus diesen beiden Gründen applaudierten sie. Der andere Text stammt von dir: „Was die Tourismusindustrie leistet, damit die Welt sich vergnügen kann(span.: divierta), müsste die Kirche in entgegengesetzte Richtung leisten, damit die Welt sich bekehren kann (span.: convierta).“ Damit hast du das Konzept verdeutlicht, das du bereits im Zusammenhang mit der Solidarität mit dem „gekreuzigten Volk“ entwickelt hattest. Es ging dir darum, dass etwas getan wird, entschieden und dialektisch. Auch dieser Text hat Geist, war aufrüttelnd und provokativ. In Aparecida sind solche Texte notwendig, die Wahrhaftigkeit mit Klarheit und Geist mit Mut verbinden. Vielleicht sind dafür die folgenden Überlegungen hilfreich:
- Freiheit statt Furcht. Ehrlich gesagt, Ellacu, in der Kirche herrscht Furcht. Es ist nicht mehr die Furcht deiner Zeit gegenüber denen, die den Körper töten können, sondern die Furcht gegenüber jenen, die unseren Wunsch nach Annehmlichkeiten untergraben, die Furcht vor der Alternative, entweder anerkannt oder zensiert zu werden. Die Furcht davor, Privilegien, Status, gesellschaftliche Macht zu verlieren. Viele von uns, Hierarchen und Priester, erwecken häufig den Eindruck, wie paralysiert zu sein. Wir müssen einfach wieder frei werden; das ist ja auch für den Glauben entscheidend: Wir sind Kinder Gottes, keine Sklaven. Wir haben in unseren Händen ein Wort, das nicht gefesselt werden kann, weil es von Gott stammt.
- Demut, Erforschung des Gewissens. In dem bereits zitierten Text von Medellín schreiben die Bischöfe weiter: „Auch uns erreichen die Klagen, dass die Hierarchie, der Klerus und die Ordensleute reich und mit den Reichen verbündet sind.“ Dann differenzierten sie die Klagen, die manchmal den Schein mit der Wirklichkeit verwechseln, und betonten die Armut der Pfarreien und Diözesen, aber am Ende stellten sie in aller Wahrhaftigkeit fest: „In der Situation der Armut und sogar des Elends, in der der größte Teil des lateinamerikanischen Volkes lebt, haben wir Bischöfe, Priester und Ordensleute das Nötige zum Leben und eine gewisse Sicherheit, während den Armen das Notwendigste fehlt und sie in Angst und Unsicherheit leben.“ Diese Aussage ist ein Beispiel für Redlichkeit und Demut, ja sogar eine Art Vergebungsbitte.
- Worte gegen das Schweigen. Wir können uns irren, aber wir dürfen nicht schweigen angesichts dessen, was die Welt von heute schwerwiegend belastet, dass zwei Milliarden Menschen mit zwei Dollar am Tag auskommen müssen. Wir reden über schwerwiegende Probleme in den Familien, mit Recht, aber wir sagen nichts gegen den Präventivkrieg – in Plan und Umsetzung – des Präsidenten Bush, der Tausende von Toten fordert. Wir klagen einige Sünden anderer an, schweigen aber über die eigenen Sünden, von denen einige schon extrem sind, außer man kann sie wirklich nicht mehr verheimlichen. Die Kirche verurteilt Ideologien, nennt bis zum heutigen Tag Faschismus und Kommunismus, aber die Ideologie des Kapitalismus als solche – nicht nur die wilden Auswüchse – wird nicht so vehement angeklagt. Auch an die Ideologie der Nationalen Sicherheit erinnert man sich nicht, die unter uns Zehntausende Tote gefordert hat, häufig durch die Hand von Christen.
- Freimut statt Feigheit. In vielen Bewegungen lebt große Begeisterung im Übermaß. Wir aber sind bei der Verkündigung Gottes so kleinlaut, wo es doch nicht um irgendeinen Gott, sondern um den Gott der Armen und Opfer geht. Die Lebendigkeit dieses Gottes zu verkünden, hängt nicht allein an der rechten Lehre, sondern ist eine Sache von Überzeugung und Freimut. Das gilt genauso für die Verkündigung Jesu, des Mannes aus Nazareth, der umherging und Gutes tat und ans Kreuz gehängt wurde. So offenbarte er sich uns als Gottes Sohn. Diesen Jesus als den größeren Bruder vorzustellen, statt ihn mit kindischen oder feierlichen Riten zu bagatellisieren, verlangt Courage.
- Respekt vor dem jeweilig Besonderen statt universale Gleichmacherei. Dass es in einer so großen weltweiten Gemeinschaft wie der Kirche zu Spannungen kommt, kann man verstehen. Aber das Problem liegt heutzutage nicht in irgendeinem geheimen Wunsch von Lokalkirchen der Dritten Welt, sich als Kirchen der Armen, der Indigenas oder der AfroamerikanerInnen, die zusammen die „große Kirche der Armen“ bilden, unabhängig zu machen. Das Problem entsteht gewöhnlich im Zentrum mit Unterstellungen, Ermahnungen, Verdächtigungen und Dankbarem. Es fehlt ein Geist der Inkulturation. Selbst wenn wir die Option für sie alle treffen, die Armen stehen nicht im Zentrum der Kirche – ebenso wenig wie im Zentrum der Demokratie –, dort stehen Reichtum und Macht.
- Ernsthaftigkeit statt Leichtfertigkeit. Es ist zwar hier und da anders, aber es tut schon weh zu sehen, wie viele Gemeinschaften um so religiöser erscheinen, je mehr die Dinge „light“ sind. Sie erinnern an die Warnung von Charles Peguy: „Weil sie nicht von dieser Welt sind, glauben sie, sie wären vom Himmel“. Dass dies bei den einfachen Menschen passieren kann, ist in gewissem Maß erklärbar. Unverantwortlich aber scheint mir, magische und zuckersüße Religiosität zu fördern, die nicht menschlicher macht. Jesus hat gesagt: „werdet wie die Kinder“, er hat nicht gesagt: „Werdet kindisch, zerbrecht euch nicht den Kopf, fragt nicht, protestiert nicht“. Sicher findet man nicht auf dem Weg des Rationalismus zu Gott, aber es ist traurig, dass bestimmte Formen von Religiosität nicht nur geduldet, sondern sogar bestärkt werden, als ob die einfachen Leute nicht fähig wären zu denken. Und noch schlimmer ist, wenn man es duldet oder fördert, weil man meint, dadurch würden sie am Glauben festhalten. Zu deiner Zeit sagtest Du, Ellacu, dass Bewusstseinsbildung wichtiger sei als Alphabetisierung. In der heutigen kirchlichen Lage müssten wir sagen, dass für den Glauben Erwachsenwerden wichtiger ist als – oftmals malerisch geschmückte – religiöse Ausdrucksformen.
- Mystagogik und Glaubwürdigkeit statt nur katechetischer Lehre. Wir müssen aber auch die andere Seite betonen. Viele werden zu selbstständigem Denken erwachen, Leichtgläubigkeit hält nicht für immer. Also muss man ihnen die Wahrheit zeigen, aber darf ihnen keine bloße Katechismuslehre vorsetzen. Deshalb wird die Mystagogik immer wichtiger, die für das Geheimnis Gottes öffnet. Das bedeutet, uns auf ein Geheimnis einzulassen, das größer ist, uns aber nicht klein macht; das ein Licht ist, uns aber nicht blendet; das uns willkommen heißt, aber nicht erdrückt. Dieses Geheimnis jedoch können wir nur weitergeben, wenn wir glaubwürdig sind. Ohne Glaubwürdigkeit gelten uns die Worte der Schrift: „Euretwegen lästert man Gottes Namen unter den Völkern“! Wenn wir mit Glaubwürdigkeit ausgestattet sind, „werden die Leute Gott preisen“.
- Kirche der Armen statt abstrakter Weltkirche. Der Traum von Johannes XXIII., von Kardinal Lercaro, von Bischof Helder Camara und Bischof Romero ist immer noch die „Kirche der Armen“ – wenn nicht ihre, wessen dann?. Das heißt: Die Armen sind nicht nur die Begünstigten einer kirchlichen Option, sondern sie sind Inspirationsprinzip. Sie lehnen nichts ab und schließen niemanden aus, aber wir können auf sie nicht verzichten, wenn wir das Christliche wirklich ganz christlich ausrichten wollen: Was wir wissen können, was wir hoffen dürfen, was wir tun müssen und was uns zu feiern geschenkt ist. Und wir alle sind dazu berufen, wenn auch unterschiedlich, in analoger Art, wie vorher gesagt, an der „realen Armut“ der Armen und am Geist der „Armen mit Geist“.
Ellacu, zum Schluss möchte ich an deine letzte Rede erinnern. „Nur zusammen mit den Armen und Unterdrückten der Welt können wir den Glauben und den Mut entwickeln, den es braucht, um zu versuchen, die Geschichte zu wenden.“ Damit sagst du uns, dass die Armen eine Quelle für Glaube und Mut sind, die uns niemand anders geben kann. Im vergangen Jahr schrieb ich dir: „Ohne die Armen kein Heil!“ Wir hoffen, dass Aparecida das bestätigt.
Und gemeinsam mit ihnen das Beste, was unsere Kirche und unser Volk beigetragen hat, die Märtyrer. Ich sehe nicht, wie wir uns versammeln können, ohne dankbar an die Tausende Märtyrer zu erinnern – so nennen wir alle, die aus Liebe ihr Leben hingegeben haben. Und weil es eine Versammlung von Bischöfen ist, müsste man doch dankbar und voller Stolz an die Brüder Enrique Angelelli, Oscar Romero, Joaquin Ramos und Juan Gerardi erinnern.
Ich weiß ja, dass der Vatikan demgegenüber verlangt, geduldig, klug und still zu sein. So aber hast du dich nicht verhalten. Drei Tage nach dem Tod von Romero sagtest du: Mit Monseñor Romero ist Gott durch El Salvador hindurch gegangen!“ Und Bischof Pedro Casaldáliga schrieb das Gedicht “San Romero de America“. Und Kardinal Carlo Maria Martini sagte am 15. Oktober 2005 in Jerusalem: “Mir scheint, sein Tod ist der eines Märtyrers der Gerechtigkeit, der Wahrheit und der Liebe. Auch wenn ich auf der Seite derer stehe, die glauben, wir müssten die Zahl der kanonisierten Heiligen nicht allzu sehr vergrößern, sähe ich es mit großem Wohlgefallen, wenn sein Mut und sein Beispiel, vor allen Dingen für die Bischöfe, offiziell von der Kirche anerkannt würde.“
Ellacu, hoffentlich kriegen wir in Aparecida wieder Wind unter die Flügel, ohne Vorwürfe und Rachegefühle, mit Großherzigkeit und Hoffnung. Aber wir müssen wieder den ursprünglich eingeschlagenen Weg finden und uns aufmachen zu einem „neuen Medellín“. In Aparecida müsste es viel „Neues“, aber auch viel von „Medellín“ geben. Denn das ist, trotz der genannten Einschränkungen, in Lateinamerika immer noch lebendig: Ordensschwestern, die unterdrückte Indigenas verteidigen, Männer und Frauen, die sich für die Menschenrechte der Armen einsetzen, mit und für Aidskranke sich engagieren; Campesinos, die sich mit den biblischen Texten befassen und Theologie lernen; Gruppen, die solidarisch mit MigrantInnen sind; Volkswallfahrten und Märtyrergedenktage; bewunderungswürdige Menschen, deren Leben nicht bekannt oder berühmt wird; Bischöfe, die sich den kleinen Leuten widmen und fest bleiben „in rebellischer Treue“… Diese Litanei guter Dinge, die die Armen tun und all jene, die sich mit ihnen solidarisieren, ist viel länger.
Der Glaube lebt. Sie glauben an Gott, der Vater und Mutter ist. An den Sohn, der Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte und Auferweckte ist. Und an den Geist, der Herr über das Leben und Lebensspender ist und der durch die Propheten spricht. Das liegt daran, dass das Evangelium wie eine kleine Pflanze ist, die wächst, sobald wir sie ein wenig pflegen. Sie mit Sorgfalt hüten, ist das Erbe von Medellín. Deshalb haben wir Hoffnung. Deshalb denken wir Jahr für Jahr an Euch, an all unsere Märtyrer. Ihr seid die Hüter und Bewahrer des Evangeliums.
Jon
Übersetzung: Norbert Arntz