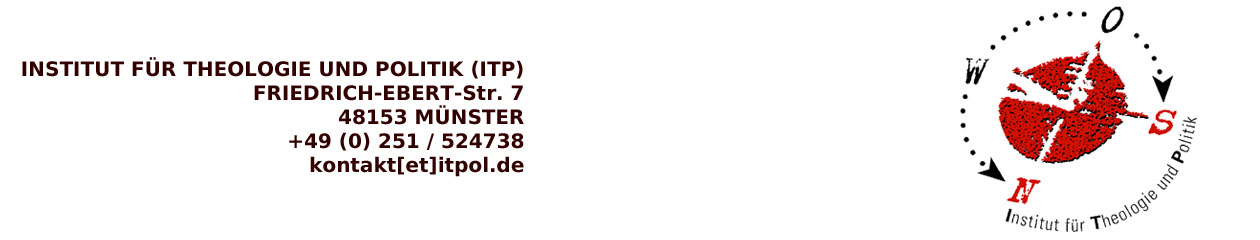Editorial
Liebe FreundInnen und Unterstützer
Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit.“. Diese Zeile aus dem Lied „Sonne der Gerechtigkeit“ war neulich Thema einer Predigt. In ihr ging es um Situation der Jesus-Anhänger nach Himmelfahrt, ihrer Orientierungslosigkeit und ihrer Angst vor der Zukunft. Der Prediger zog eine Parallele zur heutigen Situation der Christen und forderte sie auf “ … Kraft und Mut, Glaubenshoffnung und Liebesglut“�, wie es in dem Lied heißt, zu zeigen. Sowas kommt in unserer Zeit an und liegt voll im Trend der Analysen unserer Kirchenverwalter. Die „Religions- und Mythenfreundlichkeit“, wie es in der politischen Theologie noch kritisch hieß, wird heute als Hoffnungsträger für die „tote Christenheit“ verstanden. Da passt es gut, wenn der deutsche Papst dem Katholikentag zuruft: „Fasst Mut zum Bekenntnis!“ Nur: welches Bekenntnis ist hier gemeint?
Der Prophet Maleachi, der in dem Lied zitiert wird, kritisierte im 5. Jh. v.u.Z. die Selbstzufriedenheit des Gottesvolkes nach der Wiedererrichtung des Tempels. Der Tempel – die Kirche – fällt nicht mit dem Reich Gottes zusammen. Volle Kirchen und Kassen mögen dem einen oder anderen Bischof unserer Kirchen gefallen und Vorschein des Reiches Gottes sein, das Ziel unserer Hoffnung liegt aber wohl eher in der ersten Strophe des Liedes: „Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; brich in deiner Kirche an, daß die Welt es sehen kann.� Glaubenshoffnung und Bekenntnisse zur Kirche sind eine feine Sache, solange sie nicht konkret und inhaltlich werden, deshalb gibt es wohl soviel davon. Bekenntnisse zur Gerechtigkeit Gottes dagegen sind eher spärlich. Im Gegenteil scheint es im Moment eher im Trend zu liegen, sich zur Ungerechtigkeit zu bekennen, wie der Präsident der Diakonie, Herr Dr. h.c. Gohde im Mai bewies: Er forderte Kürzungen bei Hartz IV-Empfängern, um die Sozialsysteme zu sichern und die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Wie wär� es denn mal mit der Forderung nach Kürzung derArbeitslosigkeit, um unsere Gesellschaft zu erhalten, Herr Gohde?
Gründe genug, sich die Gerechtigkeit Gottes für diese Welt herbeizusehnen und unseren Teil dazu beiztutragen gibt es genug. Die Dinge so zu sehen, hat nichts mit Pessimismus und fehlendem Glaubensmut zu tun, sondern mit Realismus und Gottestreue. Soziale Ungerechtigkeit, Armut, Militarisierung der Welt fordern konkretes Engagement, z. B. nächstes Jahr bei den Gegenveranstaltungen zum Treffen der G8-Vertreter in Heiligendamm, wo die Mächtigen der Welt wahrscheinlich einmal mehr die Verhältnisse als gottgegeben absegnen werden.
Natürlich ist im Einzelnen zu streiten, wie diese Gerechtigkeit Gottes realisiert werden kann, aber gestritten werden muss darüber. Denn sonst überlassen wir die Gerechtigkeit jenen, die in dieser Welt eh schon auf der Sonnenseite stehen. Und in den vielen Auseinandersetzungen und Kämpfen dieser Welt ums Überleben (Armut) und um einen würdigen Ort zum Leben (Identität und Migration) stehen ChristInnen und die Kirchen leider noch viel zu oft im Abseits.
Gerechtigkeit muss konkret werden, ohne sie ist kein Gottesgedächtnis zu retten: Frömmigkeit, leere Bekenntnisse und volle Petersplätze in einer Welt der Ungerechtigkeit verweisen eher auf eine „tote Christenheit“- und garantieren nicht einmal funktionierende Tempel.
Wir wünschen eine gute Lektüre dieses Rundbriefes, der nun schon zum 25. Mal erscheint und einen guten Sommer – egal, ob Weltmeister oder nicht!
Ihr ITP-Team
Der Blick über den Tellerrand – Reflexionen über das Projekt „Der Süden der Städte“
Katrin Steiner
Von Anfang 2005 bis März 2006 lief unser Projekt „Der Süden der Städte“, in dem wir Auswirkungen der neoliberalen Globalisierung auf Städte und die Rolle von Initiativen und Organisationen untersuchten. In der ersten Phase beschäftigten wir uns mit Privatisierungen öffentlicher Güter, öffentlicher Räume und staatlicher Gewalt. Dabei haben wir einige Initiativen und Organisationen kennengelernt, die der neoliberalen Globalisierung ihre eigenständigen Projekte entgegensetzen und gegen Privatisierungen kämpfen. Durch ihre Arbeit konfrontieren sie die Gesellschaft mit der sozialen Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Ausgrenzung. Dabei teilen viele die Einsicht in die Notwendigkeit, ihre Anliegen gesellschaftlich breiter zu verankern, um ihrer Utopie einer gerechten Welt auch Realisierungschancen zu geben. Daher arbeiten sie mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und auch städtischen Institutionen zusammen.
Balanceakt zwischen Selbstbestimmung und Vereinnahmung
Gleichzeitig stellten wir aber fest, dass diese Initiativen und Organisationen im Zuge der neoliberalen Umstrukturierung der Städte immer häufiger in eine ambivalente Situation geraten. Von Seiten einer neoliberalen Politik, die so sehr die Eigenverantwortung propagiert, besteht nämlich durchaus Interesse an solchen Initiativen. So sehen beispielsweise städtische Institutionen selbstorganisierte Projekte als probates Mittel, notwendige Aufgaben von ihnen ausführen zu lassen und so Kosten einzusparen.
Dies bringt die Initiativen und Organisationen in ein Dilemma: Einerseits eröffnet eine Zusammenarbeit mit städtischen Institutionen Handlungsspielräume und Möglichkeiten hin zu einer größeren Demokratisierung, zu mehr Orientierung an dem, was die Menschen selbst wollen und brauchen. Andererseits laufen sie Gefahr, von einer neoliberalen Politik instrumentalisiert zu werden und ihre ursprünglichen politischen Ziele aus den Augen zu verlieren.
In der zweiten Phase des Projekts wollten wir dieses Dilemma genauer untersuchen. Dieses Mal unterstützten uns dabei drei südliche ReferentInnen: Graciela Draguicevich ist Mitbegründerin des Netzwerks Mutual Sentimiento in Buenos Aires, das sich zunächst im Kampf gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens engagierte und mittlerweile neben einer eigenen Krankenstation auch eine Offene Universität, ein Freies Radio, eine Markthalle für die Direktvermarktung biologisch erzeugter Lebensmittel betreibt. Aus Manila nahm Rhoda Viajar teil; sie hat lange Jahre beim Antiprivatisierungsnetzwerk Freedom from Debt Coalition zur Wasserprivatisierung gearbeitet und ist jetzt bei der Menschenrechtsorganisation Philippine Human Rights Information Center tätig. Schließlich konnten wir auch Boniface Mabanza aus der Demokratischen Republik Kongo gewinnen; er ist Experte für NGOs und „NGOisierung“ in Kinshasa.
Strategien für die Praxis
Zunächst gingen wir unseren Fragen in einer Tagung im Februar nach. Insbesondere in den drei Workshops wurden die unterschiedlichen Kontexte deutlich. Dabei wurde die Perspektive Argentiniens, der Philippinen und der Demokratischen Republik Kongo jeweils mit der bundesrepublikanischen konfrontiert. Trotz der Unterschiedlichkeit der Kontexte zeigte sich, wie wichtig es für Initiativen und Organisationen ist, die eigene Arbeit kritisch zu reflektieren und sensibel mit finanzieller Unterstützung von Seiten der Politik umzugehen: Um wirklich für die Demokratisierung städtischer Strukturen und kommunaler Politik sowie für eine Verbesserung der sozialen Situation in Städten eintreten zu können, ist die eigene Unabhängigkeit im Blick zu behalten. Dazu ist eine internationalistische Zusammenarbeit unabdingbar; diese beginnt sich jedoch gerade erst zu etablieren.
Während des anschließenden Besuchsprogramms lernten wir vier Projekte genauer kennen: Zunächst besuchten wir Park Fiction, einen über einen Zeitraum von 10 Jahren erkämpften Park an zentraler Stelle in St. Pauli, Hamburg. Sodann standen verschiedene soziale Einrichtungen in Wuppertal auf dem Programm: die Wuppertaler Tafel und ein Second-Hand-Möbelladen, in dem auch viele 1-Euro-Jobber arbeiten, sowie das dortige Autonome Zentrum. Der dritte Besuch führte uns zum Planerladen in der Dortmunder Nordstadt, der auch ein „Quartiersmanagement“ übernommen hat. „Quartiersmanagement“ soll in enger Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort der Verbesserung ihres „sozial schwachen“ Stadtteils dienen. Es wird vom Bund finanziert. . Abschließend besuchten wir die Medizinische Flüchtlingshilfe in Berlin-Kreuzberg, die qualifizierte medizinische Versorgung für Illegalisierte und MigrantInnen vermittelt.
Mit Bodenhaftung
Kennengelernt haben wir unterschiedliche Strategien, wie Initiativen die betroffenen Menschen im Stadtteil selbst einbeziehen bzw. wie diese sich selbst für die eigenen Belange einsetzen. Hier ist das Projekt Park Fiction ein interessantes Beispiel für die gelungene Kombination von Kunst und Politik, in der vielfältige Zugänge von und zu den Menschen in St. Pauli gesucht und ausprobiert wurden. Die Menschen wurden beispielsweise von MitarbeiterInnen des Projekts besucht und nach ihren Träumen im Allgemeinen und ihren Wünschen für die Gestaltung des Parks im Besonderen befragt. Diese konnten sie dann schriftlich, mit Knete, als Bild, Gedicht o. ä. ausdrücken und weitergeben. Häufig machten die MitarbeiterInnen des Projekts dabei die Erfahrung, dass die Menschen diese Fragen zunächst nicht ernst nahmen, weil sie in ihrem Lebensalltag selten nach ihren Vorstellungen gefragt werden. Der Prozess wurde in einem Film dokumentiert und außerdem auf der documenta in Kassel vorgestellt. Erst als dadurch eine breite, auch internationale Öffentlichkeit auf das Projekt aufmerksam wurde, konnte der Park bei der Stadt durchgesetzt werden.
Am Beispiel Wuppertal und Berlin diskutierten wir die Kombination von konkreter Hilfe und politischer Arbeit, die zum Beispiel die Sichtbarmachung der Situation (z.B. Zunahme von Armut) umfassen kann.
Bei den Diskussionen über die Besuche kristallisierte sich die Erkenntnis heraus, dass insbesondere solche Projekte, die ihre Rolle und das Verhältnis zu öffentlichen Institutionen immer wieder reflektieren und die gleichzeitig den Kontakt zu den Menschen, um deretwillen das Projekt gemacht wird, nicht verlieren, den oben beschriebenen Balanceakt meistern. Die Eindrücke und Einschätzungen unserer südlichen PartnerInnen ebenso wie die Dokumentation der Besuche und der Tagung finden Sie in voller Länge im Portal unter:
www.dersuedenderstaedte.org
Auf der Suche nach einer globalen, solidarischen Zusammenarbeit
Die Auswirkungen der neoliberalen Globalisierung stellen Bewegungen vor Ort vor immer neue Situationen. Inwieweit die Bewegungen einen möglichen Ausweg aus dieser Situation weisen, können wir nicht abschließend beantworten. Wir stellten jedoch fest, dass die Zusammenarbeit zwischen Helfenden (wie den ÄrztInnen, die die medizinische Flüchtlingshilfe Berlin unterstützen) und politisch Aktiven (wie antirassistischen Gruppen) noch in den Kinderschuhen steckt. Gerade in diesem Punkt müsste eine Verständigung stattfinden. Dies ist zunächst einmal Aufgabe der politisch Aktiven, da die Helfenden häufig mit der konkreten Arbeit ausgelastet sind. Wichtig scheint es uns zu sein, den Staat nicht aus seiner Verantwortung zu entlassen, ihm die sozialen Aufgaben nicht abzunehmen und sich nicht selbst zum Staat zu machen.
Nachdenklich stimmt uns, dass die verschiedenen Bereiche, in denen Selbstorganisationen und Basisinitiativen tätig sind (Kultur, Migration, Arbeitslosigkeit), sehr zersplittert sind und es kaum eine Gesamtperspektive gibt, um die neoliberale Hegemonie in all den Gebieten wirklich herauszufordern. Zudem müsste die Arbeit vor Ort stärker mit den Kämpfen weltweit in Verbindung gebracht werden, um der neoliberalen Globalisierung wirksam etwas entgegenzusetzen. Hier sind die sozialen Bewegungen noch auf der Suche nach gemeinsamen Strukturen. Möglicherweise sind die Weltsozialforen erste Ansatzpunkte. Auch unsere vielen internationalen Kontakte nach Lateinamerika, Asien und Afrika sehen wir vor diesem Hintergrund weiterhin als wichtig für die zukünftige Arbeit an.
Bundeswehr zur Absicherung der Wahlen in den Kongo
Boniface Mabanza
Der Kongo ist eines der reichsten Länder der Welt, sieht man auf die natürlichen Ressourcen wie Edelhölzer, Bodenschätze (Diamanten, Kupfer, Kobalt, Coltan, Zink, Uran) und auf die Tierwelt (Okapis, Berggorillas). In dem Land, dessen Fläche so groß wie ganz Westeuropa ist, lebt aber eine der ärmsten Bevölkerungen der Welt. Es gibt unermessliche Wasserreserven, aber die Mehrheit der Bevölkerung hat keinen Zugang zu Trinkwasser. Der Kongo produziert mit seinen Staudämmen jede Menge Strom, für die Mehrheit der Bevölkerung bleibt ein Stromanschluss ein unerfüllte Traum.
Die Debatte in Deutschland
In Deutschland gibt es eine Debatte über die Beteiligung der Bundeswehr am EU-Einsatz zur Absicherung der Wahlen Ende Juli im Kongo. Es wird über zeitliche und räumliche Ausdehnung der Mission, über Zahl der beteiligten Personen, über die Führung des Einsatzes, über die Finanzierung und nicht zuletzt über Aufgabe und Sinn des Einsatzes diskutiert.
Trotz aller Widersprüche und unterschiedlicher Positionen gibt es einen gemeinsamen Punkt in in der hierzulande geführten Diskussion: Die Staatskrise im Kongo erscheint als eine innerkongolesische Angelegenheit. Dabei scheinen viele Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in der zentralafrikanischen Region einfach vergessen zu sein. Denn die Krise ist nicht „hausgemacht“, sondern Folge äußerer Einflussnahme auf die nachkoloniale Entwicklung des Landes.
Wenige Monate nach der Erklärung der nationalen Unabhängigkeit wurde der bisher einzige Versuch des Aufbaus einer echten Souveränität durch die Ermordung des ersten Ministerpräsidenten Patrice Lumumba zunichte gemacht. Es gibt viele Studien über die Beteiligung der ehemaligen Kolonialmacht Belgien und der USA an dieser Trag�die. Es folgte eine lange Zeit der Instrumentalisierung und der Ausplünderung des Landes.
Demokratisierung im Kongo
Als Folge der internationalen Großwetterlage begann Anfang der 1990er Jahre ein Demokratisierungsprozess, der vor allen Dingen von innen heraus betrieben wurde. Von außen wurde er eher behindert, weil ein „neues Pferd“, das Mobutu Sese Seco als Präsident ersetzen musste, noch nicht gefunden war. Hätte man die Demokratisierung unterstützt, wäre dem Kongo der Krieg mit seinen Folgen erspart geblieben. Mit Beginn des Krieges 1996 fand diese Demokratisierungsphase ein frühes Ende. Der Krieg begann zunächst als Operation der rwandischen Armee im Osten des Kongo, um nach dem Genozid gegen die Hutu in der Grenzregion vorzugehen. Damit war ein zweiter rwandischer Genozid geschaffen, über den bis heute wenig geredet wird.
Kongo, Rwanda und Uganda
Mit Unterstützung von Rwanda und Uganda entstand die Allianz demokratischer Kräfte zur Befreiung des Kongo, die 1997 weite Teile des Kongo eroberte und deren Sprecher Laurent-D. Kabila 1997 in Kinshasa die Macht übernahm. Er gab sich bald nationalistisch und verfolgte eine Politik der Autonomie gegenüber seinen bisherigen Verbündeten Rwanda und Uganda. Er revidierte Verträge mit westlichen Firmen und suchte Annäherung an China, Cuba, Nordkorea und Libyen. In Reaktion darauf begann im August 1998 ein zweiter Krieg, der zunächst als Blitzkrieg gedacht war, dann aber zu einem Regionalkrieg mit Beteiligung von sechs afrikanischen Ländern wurde. Die Bilanz dieses Krieges ist bekannt: vier Millionen Tote, systematische Zerst�rung sozialer Infrastrukturen, unbeschreibliche Plünderungen kongolesischer Ressourcen.
Inzwischen gibt es eine Übergangsregierung, angeführt vom Präsidenten Joseph Kabila und von vier Vize-Präsidenten. Diese Regierung hatte die Aufgabe, die territoriale Integrität wieder herzustellen, die Staatsautorität auf dem gesamten nationalen Territorium zu sichern und demokratische Wahlen vorzubereiten. Nach mehreren Verschiebungen wird als Wahltermin jetzt der 30.7.2006 angestrebt. Unterstützt werden diese Bemühungen vom größten, teuersten, aber auch von einem der ineffizientesten UN-Einsätze der Gegenwart.
Es ist aber bisher nicht gelungen, die Gebiete im Osten des Kongo zu kontrollieren: Kaum jemand glaubt daran, dass Rwanda seine Truppen aus dem Ostkongo komplett abgezogen hat. Diese unterhalten dort weiterhin Milizen und arbeiten daran, den Kongo unter ihrer Kontrolle zu behalten. Rwanda und Uganda exportieren nach wie vor unkontrolliert Rohstoffe, die in diesen Ländern nicht vorkommen.
Die Wahlen und Europa
Von daher kann man erahnen, was nach den Wahlen passieren könnte. Die Wahlverlierer werden versuchen, mit ihren jeweiligen Rebellenbewegungen und unterstützt von den jeweiligen ausländischen Mächten, Unsicherheit zu verbreiten, um dann über neue Verhandlungen Einfluss auf die politische Landschaft des Kongo zu nehmen. Ein EU-Einsatz, der nicht nur der Gewissensberuhigung dienen soll, muss sowohl militärisch als auch politisch entschlossen angegangen werden: Schon vor den Wahlen müssen die bekannten Unruhestifter und Menschenrechtsverbrecher festgesetzt und zur Rechenschaft gezogen werden. In dieser Hinsicht ist die Einschränkung des Einsatzes auf Kinshasa eine merkwürdige Entscheidung angesichts der Tatsache, dass der Brennpunkt der Ostteil des Landes ist. In Richtung Rwanda und Uganda muss ein deutliches Signal gehen, den Stabilisierungsprozess im Kongo nicht weiter zu stören. Da sich bisher beide Länder auf die Unterstützung durch die USA und Großbritanniens verlassen können, muss die EU-Politik auch diese in ihre Kongo-Politik einbinden. Die Zurückhaltung der USA gegenüber dem EU-Einsatz im Kongo ist ein Zeichen, das eher auf Misstrauen deutet. Außerdem stößt der EU-Einsatz bei den Einheimischen auf Skepsis, weil er gegenüber den jeweiligen nationalen Öffentlichkeiten mit den „eigenen Interessen“ begründet wird, ohne diese überzeugend zu nennen. Diese Skepsis ist berechtigt bei einem seit dem 16. Jahrhundert ausgebeuteten Volk.
Das Vertrauen kann nur hergestellt werden, indem ein umfangreiches Konzept vorgelegt wird, das sowohl die internen als auch die externen Faktoren der kongolesischen Krise berücksichtigt, damit endlich Interessen des kongolesischen Volkes und keine ausländischen Interessen unter dem Deckmantel einer humanitären Intervention Berücksichtigung finden.
Der unterbrochene Frühling – Das Projekt des II. Vatikanums in der Sackgasse
Michael Ramminger
„Für uns gibt es keinen sicheren Hafen mehr, keine garantierte Instanz a priori, keinen heiligen Stuhl, der uns ex cathedra und ex officio lehren und sagen könnte, was wir tun sollen, wohin wir gehen sollen.“ Dieses Zitat des brasilianischen Befreiungstheologen Alberto da Silva Moreira beschreibt sehr präzise die Situation der katholischen Kirche vierzig Jahre nach dem zweiten Vatikanischen Konzil. Aber auch das II. Vatikanum war nicht dieser sichere Hafen, von dem aus die Kirche zu neuer Wirkmächtigkeit und Universalität hätte aufbrechen können. Es war ein Weg mit offenem Ende, ein Prozess der Suche nach neuen Wegen, der gerade wegen seines offenen Charakters mit aller Macht vom Vatikan verhindert wurde. „Das II. Vatikanum hat vieles reformiert, nur nicht die Kurie“ schreibt einer der Gründer der Befreiungstheologie, José Comblin, und verweist damit auf das zwangsläufige Scheitern dieses Versuchs. Die Herausforderungen des Konzils: die Öffnung zur Welt, das Suchen nach den Zeichen der Zeit, seine Konkretisierung in der Option für die Armen aber bleiben bestehen.
Auf dem Spiel steht heute nichts weniger als die Zukunft des Christentums, natürlich auch der Kirche. Trotz ihrer Schwächung hat die Befreiungstheologie dies begriffen, ebenso wie der alte und der neue Papst. Nur die Konsequenzen sind andere. Vielleicht war es der größte Fehler des Konzils, dass es zwar eine Sozialethik, aber keine Kapitalismuskritik hatte, wie Francois Houtard meint. Denn es ist der Kapitalismus, seine Ästhetik und sein Menschenbild, die Warenförmigkeit der Welt, die das Christentum immer überflüssiger machen. Und die Rettung heißt nicht Religion und Frömmigkeit.
Der Weg ist vorgezeichnet: gemeinsam mit den Anderen (Paulo Suess), die am Wegrand stehen, die den Anfang gemacht haben, voranzuschreiten. In der Befreiungstheologie werden die ersten Schritte gemacht: neue Reflexionen, Praxen der Solidarität und der Ökumene. Davon könnte die deutsche Theologie lernen: „Wenn es also wahr ist, dass die Hoffnung ein Weg ist, ist es auch wahr, dass man aus den Stolpersteinen – wenn auch unter Schmerzen – eine neue Straße pflastern kann, oder wenigsens einen neuen Pfad.“
Ein Buch zum II. Vatikanum, seinen Folgen und Herausforderungen wird in diesem Jahr erscheinen. Mit Beiträgen von: Francois Houtard/ Belgien, José Comblin/Brasilien, Paulo Suess/Brasilien, Alberto da Silva Moreira/Brasilien, Marcelo Barros/ Brasilien, José Maria Vigil/ Panama u.a. , hrsg. von: Alberto da Silva Moreira, Afonso Maria Ligorio Soares, Michael Ramminger. Edition ITP-Kompass, Münster 2006.
Solidarität mit dem Iran?!
Soussan Sarkosh
Seit 2001 ist im ITP das Redaktionsbüro der Zeitschrift Peripherie beheimatet. Im Dezember 2005 wurde der 25. Jahrgang abgeschlossen. Aus diesem Anlass fand in Berlin eine Jubiläumstagung statt. Zur Eröffnung hielt Soussan Sarkhosh aus Teheran einen Grundsatzvortrag, mit dem sie mitten in die Herausforderungen internationaler Solidarität hineinführte. Im Folgenden dokumentieren wir Auszüge aus diesem Vortrag.
[…] Ein Jubiläum ist auch Anlass zur Reflektion, Reflektion über die vergangene Zeit, über das Erreichte, und über die Pläne für die Zukunft.
Islamische Revolution
Diese 25 Jahre habe ich im Iran gelebt, im ersten real existierenden Gottesstaat. Ich nahm an jenen Ereignissen teil, die dann als islamische Revolution in die Geschichte eingingen, obwohl wir, d.h. ich und viele andere, die diese Revolution vorbereiteten, keine Islamisten waren. Wir waren, was man moslemische Atheisten nennen könnte, und wir waren nicht wenige: die Mehrheit der politischen Gefangenen unter dem Schahregime.
Meine Erfahrung in einem solchen Staat führte dazu, dass einige Missverständnisse zwischen mir (der Peripherie) und jenen entstand, die in den Zentren der Welt über die Peripherie reflektierten und die PERIPHERIE herausgaben. […] In den Zentren war eine berechtigte anti-globale Bewegung entstanden. Es war modern, postmodern zu sein, man kritisierte die Aufklärung und die Moderne. Man überdachte den Prozess der Säkularisierung neu. All dies befremdete mich sehr. Ich entdeckte viele Affinitäten zwischen dem postmodernen Denken und dem islamistischen Credo.
Unsere Erfahrung hatte gezeigt, dass Desintegration auch kein Allheilmittel ist, dass ein Land dadurch nur auf seine engen traditionellen Grenzen zurückgeworfen wird; dass wir die Errungenschaften der Moderne gegen fundamentalistische Angriffe verteidigen mussten…
Die Moderne
Moderne bedeutet für mich sowohl das Projekt der Aufklärung (Habermas) als auch die realen Errungenschaften der Metropolen: die demokratische Staatsform, die Technologie und Wissenschaft, das städtische Leben (Giddens), aber auch die Theorien von Marx und Freud, die Arbeiterbewegung und die Frauenbewegung. […]
immer wenn ich in Deutschland einen Text verfassen will, um … meine Kritik an den Verhältnissen in meinem Land zu formulieren, gerate ich in eine prekäre Situation. Vor etwa 16 Jahren musste ich entdecken, dass man in den Zentren der Welt dabei ist, einen neuen Feind zu konstruieren, den Islam. Stichwort dazu: Kampf der Kulturen. Und heute sehen wir, wie man auf beiden Seite versucht, diese konstruierte Feindschaft zur Eskalation zu bringen. […] Damals, vor 1980, war die Welt für uns in Ordnung, die Bösen waren böse und die Guten waren gut, wir wussten wo wir uns verorten können. […]
Auf der einen Seite standen die Reichen, die Kapitalisten, die Imperialisten, die Diktatoren, und auf der anderen Seite die Armen, die Arbeiter, die Menschen in der Dritten Welt, die Befreiungsbewegungen in der Peripherie. […]
Aber schon 1980 begann dieses Bild zu bröckeln, wenigstens für uns in Iran. Im Iran bejubelten die armen Massen, die ehemaligen Akteure der Revolution, die Hinrichtung der ehemaligen Revolutionäre, sie halfen bei deren Verfolgung. Die liberalen, demokratischen und linken Gegner des Schah-Regimes wurden verfolgt. Ein Krieg brach aus, zwischen Iran und Irak. Zwischen zwei Regimes, die sich antiimperialistisch dünkten.
… alles wurde schwarz
Das neue Regime genoss die Unterstützung der Massen, so konnte es acht Jahre Krieg führen. Aber das Land versank in materielle und geistige Armut:. Das Licht verschwand: Alles wurde schwarz, von der Bekleidung der Frauen bis zum intellektuellen Klima … kurz, sowohl die Menschenrechte als auch der Sozialismus galten auf einmal als westlich und wurden verfemt.
Auf der anderen Seite war das neue Regime kein Handlanger der Großmächte … Auf der internationalen Szene verband es sich mit den armen Ländern des Südens …
Wie sollte man nun Partei ergreifen, wo sollte man sich verorten? Auf der Seite des neuen Regimes, oder auf der Seite seiner Gegner: Irak, USA, Schah-Anhänger? …
Und heute? … die Welt ist immer noch nicht in Ordnung, unsere damaligen Probleme haben sich nun globalisiert. Denn heute erleben wir jeden Tag: Bombenanschläge in Metropolen, 11. September in New York, 11. März in Madrid und 7.Juli in London. Alles im Namen der Unterdrückten.
Bombenanschläge im Irak und sonstigen Ländern der Peripherie, wieder im Namen der Unterdrückten, der Entrechteten, im Namen des Islams. Überall viele Tote, meist ganz normale Sterbliche, alt und jung, aus allen Schichten. Und jeden Tag Eingriffe der USA und ihrer Verbündeten in irgendeinem Land der Peripherie, gestern in Afghanistan, heute in Irak, und morgen? Bombardierung dicht besiedelter Stadtteile, Folterung mutmaßlicher Terroristen, alles im Namen der Freiheit, der Demokratie, der Zivilisation. […]
Wo stehen wir?
Wo stehen wir, wo sollten wir uns verorten? Welche reale, wirklich existierende Alternative haben wir? Mit „wir“ meine ich Menschen, die weder Bush, d.h. eine amerikanische oder internationale Besatzung wollen, noch talebanische Zustände. […] Ich habe keine Antwort, obwohl ich mich immer noch als Sozialistin fühle, aber eine, die keinen der real existierenden Sozialismen als Sozialismus bezeichnen kann. […]
Aber keine Lösung und keine Antwort zu haben, scheint mir, ist kein Grund zur Resignation, sondern eine Herausforderung, eine Herausforderung an alle in der Peripherie und in der PERIPHERIE.… – an alle Intellektuellen im Süden und im Norden, die immer noch an der Verwirklichung jener Forderungen festhalten, die zum ersten Mal in der Französischen Revolution formuliert und seitdem in allen sozialen Bewegungen und Revolutionen immer wieder erneuert und mit neuen Inhalten gefüllt wurden: Liberté, Egalité, Solidarité. Und ich denke , dass das Denken in Dichotomien uns nicht weiterhelfen kann. […]
Der Weg ist weder gerade noch kurz. Was 500 Jahre brauchte, um seine heutige Gestalt anzunehmen, wird man nicht über Nacht ändern können, aber auch nichts ändert sich von selbst. […]
Ich möchte auch allen viel Mut und Kraft wünschen und mit einem Wort meines Lehrers schließen:
„Es gibt keine Landstraße für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.“ (Karl Marx: MEW 23, S. 31)
MultiplikatorInnen gegen den Neoliberalismus: „Alternativen sind möglich …“
Es mag den Anschein haben, als sei die neoliberale Politik des Sozialstaatsabbaus, der Privatisierungen und der Ich-AGs etwas leiser geworden. Aber der Schein trügt. Das Elend der Bildung, Altersarmut und Arbeitslosigkeit von Jungen und Alten nimmt weiter zu: Wer nicht mitkommt, ist draußen! Eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung über die Welt, die wir wollen, Sachkompetenz über die sog. Globalisierung und den Lohnkostenkrieg und Fantasie und Kreativität für eine Welt, in der alle leben können, ist nötig.
Im Rahmen ihres Arbeitnehmerbegehrens hat nun die IG-Metall die Initiative ergriffen. Hunderte von Multiplikatoren gegen diese Politik sollen in gewerkschaftlichen und lokalen, regionalen und überregionalen Seminaren ausgebildet und weitergebildet werden. Das Neue daran: die Materialien, Sachtexte, Methodenvorschläge und Diskussionsideen wurden von einer Gruppe erarbeitet, in der auch Vertreter von sozialen Bewegungen wie ATTAC und kirchlichen Institutionen mitgearbeitet haben. Herausgeber ist der Vorstand der IG Metall. Wer Lust und Spaß hat, mitzumachen, selber Seminare, Vorträge etc. anbieten möchte, kann sich beim IG Metall-Bildungszentrum Sprockhövel, Otto Brenner-Str. 100, 45549 Sprockhövel, Frau Petra Wolfram, bei attac oder beim ITP melden.
G8-2007 – Herausforderung für eine breite Protestbewegung
Im nächsten Jahr treffen sich die G8-Staaten in Heiligendamm an der deutschen Ostseeküste. Eine Gelegenheit für die verschiedenen Gruppen, die sich in Deutschland für eine gerechtere Welt engagieren, zusammenzuarbeiten und gemeinsam einen wirkungsvollen Ausdruck des Protests zu organisieren!
Schon seit ca. einem Jahr laufen verschiedene Vorbereitungstreffen, Info-Touren und Veranstaltungen zum Thema G8. Vor Ort, wie zum Beispiel hier in Münster, tun sich Grupen und Einzelpersonen zusammen, um die G8-Themen wie Sicherheit, AIDS und Energiepolitik und ihre Bedeutung für die lokalen Verhältnisse zu diskutieren, und organisieren Informationsveranstaltungen und Aktionen.
Im März fand in Rostock eine Aktionskonferenz statt, die der Startpunkt dafür war, ein breites Spektrum von der Linkspartei/WASG über Gewerkschaften, attac bis zu kirchlichen, autonomen und antifaschistischen Gruppen ins Gespräch zu bringen und ein breites Bündnis zu bilden. Ob daraus etwas wird oder ob es weiterhin viele kleine Bündnisse geben wird, die je nach politischer Ausrichtung und Milieu ihren Protest vereinzelt zum Ausdruck bringen, wird sich im nächsten Jahr zeigen. Es ist zu wünschen, dass viele Menschen gemeinsam zum Ausdruck bringen, dass die Politik der G8 keinerlei demokratische Legitimation hat und daß ihr Treffen ein Steuerinstrument der reichen Länder ist, um sich ihre Vormachtstellung zu sichern.
weitere Infos z.B. über
www.g8-2007.de www.heiligendamm2007.de
www.gipfelsoli.org