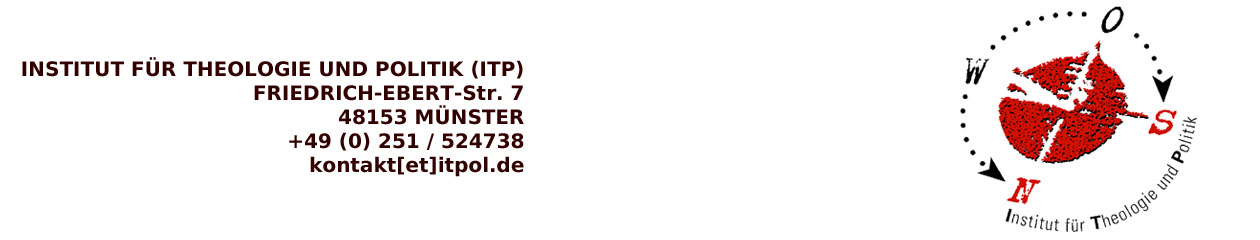editorial
Liebe Freunde und Freundinnen, müsste dieser Rundbrief nicht eigentlich mit einem Artikel zur Weltwirtschaftskrise beginnen, mit einem Kommentar zum vermutlich noch ausstehenden „dicken Ende“ mit Arbeitslosigkeit, Armut etc., der Meldung, dass die Krise nun auch schon wieder einmal die Ärmsten der Armen überall auf der Welt trifft? Aber genauso wichtig wären dann wohl auch Beiträge über den zumindest vorübergehend eingestellten Krieg der israelischen Regierung und Armee gegen die Palästinenser, das Massaker der sri-lankesischen Armee an den Tamilen, an dem die EU nicht unerheblichen Anteil dadurch hat, dass sie die LTTE als terroristische Organisation eingestuft hat. Und genauso wichtig wären Beiträge über die Kriege in Afghanistan und Irak, die stillschweigende Militarisierung der Bundesrepublik nach außen (und nach innen) oder die weltweit zunehmende Umweltzerstörung… Die Welt ist nicht in Ordnung. Gut, das wissen wir – und nun? Weitermachen! Und das nicht nur aus moralischen Gründen, was im Ernstfall nur zur Verbitterung führt, sondern weil wir darauf setzen und hoffen, dass eine Welt ohne Armut, Ausbeutung und Unterdrückung möglich ist und kommen wird. Und weil das unser „gutes Leben“ ist. In diesem Sinne finden Sie in diesem Rundbrief eine unzulängliche Auswahl unserer Arbeitsprojekte und unserer Themen und wir wünschen allen FreundInnen einen guten Sommer,
Ihr ITP-Team
„Eine andere Welt ist möglich“.Das 9.Weltsozialforum hält an der Utopie fest
Vom 27. Januar bis 1. Februar 2009 fand das 9. Weltsozialforum statt, diesmal in Belém, der größten Stadt im Bereich des wasser- und regenwaldreichen Mündungsgebietes des Amazonas. Am Weltsozialforum nahmen mehr als 100.000 Menschen teil. In den Tagen vor dem Weltsozialforum trafen sich ca. 1300 Männer und Frauen zum Weltforum für Befreiung und Theologie. Der Ort, Belém, mit über einer Million Einwohner zweitgrößte Stadt im Amazonasgebiet, war für die Treffen gewählt worden, um die Zusammenhänge von Weltwirtschaftsordnung und ökologischer Zerstörung in die Weltöffentlichkeit zu bringen: die Vernichtung des Regenwaldes durch Abholzung für großflächige Rinderzucht oder Förderung von Bodenschätzen, Öl und Gas und die Konflikte um Land.
Vom Institut für Theologie und Politik nahmen Norbert Arntz, Michael Ramminger und Ludger Weckel an diesen Treffen teil. Sie haben ihre Eindrücke und wichtige Ergebnisse der Treffen noch während ihres Aufenthaltes in Brasilien auf die Internetseiten des ITP (www.itpol.de/?cat=1) gestellt. Im Folgenden dokumentieren wir einige Aspekte ihres Berichts.
Zwei große Konfliktbereiche stehen aktuell im Vordergrund: Brasilien möchte seine Energieversorgung von Ölimporten unabhängig machen und auf Wasserkraft umstellen. Deshalb plant die staatliche Energieversorgungsgesellschaft Electronorte mehrere gigantische Staudammprojekte, durch die riesige Flächen geflutet werden sollen. Die dort lebenden Menschen, Indio-Völker und Dorfgemeinschaften am Fluss sollen verschwinden oder verlieren durch die Aufstauung ihre bisherige Lebensgrundlage. Auf dem Weltsozialforum stießen in diesem Punkt die Interessen von Gewerkschaften (für die Staudämme) und der Organisationen von Bewohnern der Region, Umweltschützern und der Kirchen aufeinander. Außerdem nimmt die extensive Landnutzung der Agroindustrie für Soja, Viehzucht und Biokraftstoff zu.
Diese Konflikte wurden von den TeilnehmerInnen aus der Region, den vielen Indios, den in bescheidenen Verhältnissen am und vom Fluss lebenden „Riberinhos“ (den Menschen am Fluss), den Kleinbauern und den Bewohnern von Stadtrand-Favelas deutlich angesprochen. Klar wurde aber auch, dass ein (politisch notwendiger) Schutz des Regenwaldes nicht gelingen kann, wenn nur die Länder die Kosten tragen, in denen der Regenwald heute liegt. Auch die Länder müssen sich verantwortlich und finanziell beteiligen, auf deren Gebiet es keinen Regenwald (mehr) gibt und die deshalb auf die „grüne Lunge“ der Welt angewiesen sind.
Die Kirchen waren auf dem Weltsozialforum auch präsent, zumindest die befreiungstheologisch orientierten Teile. So trug ein großes Veranstaltungszelt den Namen der vor vier Jahren in Amazonien von Großgrundbesitzern ermordeten US-amerikanischen Ordensfrau Dorothy Stang. Sie hatte sich öffentlich für den Erhalt des Regenwaldes und gegen die Vertreibung von Kleinbauern eingesetzt. Als wir wenige Tage später in der Prälatur Altamira unterwegs waren, hatten wir die Gelegenheit, an der Erinnerungsfeier anlässlich des 4. Jahrestages ihres Martyriums teilzunehmen. Mehrere hundert Menschen erinnerten in einem Gottesdienst mit Bischof Kräutler an ihr Wirken.
Während unseres Besuchs in Altamira konnten wir mit Hilfe eines Mitarbeiters des Indianermissionsrates CIMI auch eine mehrtägige Fahrt auf dem Fluss Xingu unternehmen und die Gebiete besuchen, die von den Staudammplanungen direkt betroffen sind, und uns so über die Konflikte und die Kämpfe gegen das Staudammprojekt informieren. Das Unternehmen Elektronorte unternimmt viel, um die Menschen mit Versprechungen (Arbeitsplätze, Straßenbau etc.) auf seine Seite zu bringen. Es wurde aber deutlich, dass es Teile der Bevölkerung gibt, die bereit sind, für ihre Rechte und gegen die Zerstörung ihres Lebensraumes zu kämpfen. Welche Chancen sie letztlich haben werden, hängt auch davon ab, inwieweit dieser Konflikt internationalisiert werden kann, inwieweit also Organisationen in den USA und in Europa in den Konflikt einsteigen und die staatlichen und privaten Finanzierungsquellen für das Staudammprojekt, die eindeutig im Norden liegen, unter Druck setzen und austrocknen können.
Für uns hat nicht nur das Weltsozialforum, sondern auch die anschließenden Besuche an den Flüssen des Amazonasgebietes einmal mehr deutlich gemacht: Eine andere Welt ist möglich, allerdings bedarf es dazu einer deutlichen Umkehr. Es gibt kein „Heil“, wenn man versucht, es an den Armen vorbei zu erlangen. Und die Menschen in Amazonien, die Menschen, die unter einfachen Verhältnissen an den Flüssen leben, zeigen ansatzhaft: Es geht darum, die Beziehungen im menschlichen Zusammenleben nicht durch „Besitz“ zu konstruieren, sondern einfach zu leben, damit alle Menschen leben können, alle in der Welt einen Platz haben. Ein erster Punkt, so die Erklärung der Versammlung der sozialen Bewegungen zum Abschluss des Forums, wäre, dass die Reichen und nicht die Armen die Folge der Krise bezahlen.
crossroads – kreuzungen
Ludger Weckel
Das Institut für Theologie und Politik ist an der Vorbereitung und Durchführung des internationalen missionswissenschaftlichen Kongresses „Crossroads“ beteiligt, der vom 7.-10. Oktober 2009 in Münster stattfinden wird. Der Kongress wird federführend vom Institut für Missionswissenschaft an der Universität Münster vorbereitet und von namhaften kirchlichen Einrichtungen wie dem Bistum Münster, Adveniat und Missio Aachen katholischerseits und vom Evangelischen Missionswerk und der Vereinigten Evangelischen Mission in Wuppertal evangelischerseits unterstützt.
Der Kongress verbindet missionswissenschaftliche und pastoraltheologische Fragestellungen, indem er nach der Situation und den Herausforderungen fragt, die sich durch Migration von ChristInnen aus allen Weltteilen und ihren „Christentümern“ für die Praxis der Kirche als „Weltkirche“ ergeben. Weil es um Bewegungen und Begegnungen geht, ist der Titel des Kongresses „Crossroads“, Kreuzungen, auf denen man sich begegnet, wichtige Richtungsentscheidungen trifft und wo es gegenseitiger Rücksichtnahmen bedarf.
Zur Teilnahme am Kongress sind MitarbeiterInnen und Interessierte aus den Bereichen Theologie, Seelsorge, Gemeinde, Solidaritätsarbeit und Bildung/Schule eingeladen.
ReferentInnen aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas, Asiens und Afrikas sowie Europas haben ihre Mitwirkung zugesagt. So werden auch mehrere ReferentInnen erwartet, mit denen das ITP in den vergangenen Jahren schon mehrfach zusammen gearbeitet hat, zum Beispiel Alberto Moreira, Nancy Cardoso und Luiz Carlos Susin aus Brasilien und Gemma Tulud Cruz aus den Philippinen (heute USA).
In Vorträgen und in Arbeitsgruppen werden die „Kreuzungen“ bestimmt, auf denen „Christentümer in Bewegungen und Begegnungen“ aufeinander treffen: Globalisierung und Migration schaffen Nähe und Herausforderungen. Vor allem in Städten begegnen sich Christinnen und Christen aus allen Weltteilen. Hier zeigt sich christliche Identität im Plural, in Christentümern: z. B. mitteleuropäisch, pfingstlich, charismatisch, afrikanisch, aufgeklärt, enthusiastisch, arm, reich, … Durch Migration, aber auch durch Engagement für globale Gerechtigkeit geraten sie in Bewegung und begegnen einander – manchmal wie Fremde, z.B. im Nebeneinander von „Migrationsgemeinden“ und bestehenden Kirchen. Begegnung allein bedeutet noch nicht Verstehen und Akzeptanz. Auch Konflikte gehören zur Realität zwischen Christentümern. Crossroads fordern das christliche Zeugnis heraus. Der gemeinsame Bezug auf das Evangelium, die Hoffnung auf Befreiung, Leben und Heil für alle Menschen, verlangen die Bereitschaft zu ökumenischem Lernen.
Die MitarbeiterInnen aus dem ITP werden im Rahmen des Kongresses verschiedene Arbeitsgruppen anbieten, z.B. zu „Frauen, Migration und Glaube“ und zu „Politik, Solidarität und christlicher Glaube“. Weitere Informationen zum Kongress, zu den Workshops und eine Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter:
www.crossroads2009.de
Die K-Frage stellen: Krise, Kapitalismus, Kairos?
Katja Strobel
Noch ein Kommentar zur Wirtschaftskrise? Eigentlich würde es ausreichen, Zitate von Regierenden zur ‚Krisenlösung‘ aneinander zu reihen, um ein Kabarettprogramm zu füllen – die Verdummung scheint grenzenlos, vor allem aber grenzenlos wirksam. Trotzdem drängt sich immer wieder die Frage auf: Wie lange noch hält sich das Märchen von den ‚Auswüchsen‘ des Kapitalismus, die nur zurück geschnitten werden müssten, um eine alternativlose ‚soziale Marktwirtschaft‘ zum Blühen zu bringen?
Handlungswille ist nicht erkennbar
Der ‚Krisengipfel‘ von Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften am 22. April brachte die düsteren Aussichten zum Ausdruck, signalisierte jedoch keinerlei Handlungswillen: Die Prognosen von einem ‚Negativwachstum‘ des BIP von -5,6%, von kontinuierlich ansteigender Massenerwerbslosigkeit brachten nebulöse und lediglich bald diffamierte ‚Warnungen vor sozialen Unruhen‘ von Seiten des DGB-Vorsitzenden hervor. Neoliberale Politik setzt sich unirritiert fort: Die Bankenrettungspakete signalisieren staatlich abgesichertes Unrecht; ein autoritärer Staat steht für Gewinngarantien von Banken und Konzernen. Die Fortsetzung dieser Doktrin wurde auch auf dem G20-Gipfel in London zum Ausdruck gebracht. 250 Mrd. US-Dollar sollen in den nächsten zwei Jahren in den Welthandel gepumpt werden, und die eigentlich ausgediente Finanzinquisition IWF kommt zu neuen Ehren: 1 Billion US-Dollar werden ihm zur Verfügung gestellt.
Neokolonialismus
Auf EU-Ebene ist Ähnliches festzustellen: Die ‚Hilfen‘ der EU für die Länder mit Zahlungsschwierigkeiten werden an Verpflichtungen geknüpft, die die Souveränitätsrechte aushebeln und der EU-Kommission erhebliche Mitspracherechte in der Haushaltspolitik garantieren, ähnlich wie dies der IWF mit den Ländern des ‚globalen Südens‘ praktiziert: Kredite werden an Verpflichtungen zur direkten Rückzahlung an die reichen Länder geknüpft. Ungeachtet der Tatsache, dass die reichen Länder die Krisen teilweise erst verursachten bzw. in ihrem Ausmaß verschärften, indem die in die neu eingetretenen Länder transferierten Gelder im Zuge der Krise einfach wieder abgezogen wurden, erhalten sie ein effektives Instrument zur Kontrolle. Über diese neokolonialen Strukturen wird größtmögliche Intransparenz verhängt: Weder ist bisher eine vom EU-Parlament längst geforderte Analyse der Geldtransfers erstellt worden, noch erhält es Informationen über die Absichtserklärungen zwischen der Kommission und den betroffenen Mitgliedsstaaten.
Kapitalismus und Neoliberalismus sind nicht am Ende
Hintergrund der Krise ist lediglich die konsequente Entwicklung des Kapitalismus: Neoliberale Politik sichert seit Jahrzehnten weltweit ein Wirtschaftssystem ab, das Spaltungen verschärft. Seit den 1980er Jahren wurden horizontale Fusionen forciert, die die seit dieser Zeit charakteristischen transnationalen Konzerne und ihre „Weltmarktführerschaften“ hervorbringen. Durch die weltweit gegliederte Produktion werden die Unterschiede zwischen verschiedenen ArbeiterInnen massiv verschärft: „Gut (oft übertariflich) bezahlte und ausgebildete Beschäftigte in den industriellen Großkonzernen, daneben ArbeiterInnen in traditionellen Berufen, die jedoch oft schon mit Zeitverträgen auskommen müssen, dann LeiharbeiterInnen – bis hin zur Armutsarbeit und Arbeit von „Illegalen“, die teilweise unter schlimmsten Bedingungen schuften.“1 Neben diesen seit Jahren festzustellenden Entwicklungen sind jene riesigen Fusionen aber nur durch Kredite zu realisieren – und dass nach einem mehr als zwanzigjährigen Höhenflug das Kreditsystem an seine Grenzen kommt, kann niemanden verwundern. Die Auswirkungen bekommen wir nun zu spüren; Schäffler, Commerzbank und Porsche sind prominente Beispiele für Konzerne in der BRD, die nun für ihre Übernahmen staatliche Finanzspritzen in Anspruch nehmen müssen.
Die Frage ist nur: Schafft es der Kapitalismus mit Hilfe seiner Selbstheilungs- und Integrationskräfte und seiner Verblendungszusammenhänge einmal mehr, über die Krise hinwegzukommen? Bisher hat es den Anschein, als gebe es Anlass zur Annahme – manche mögen es ‚Hoffnung‘ nennen – , dass dies der Fall ist.
Wider die schale Hoffnung
Auf der letzten Tagung der Arbeitsgemeinschaft Feminismus und Kirchen gab es eine heftige Diskussion darüber, wie legitim es ist, von „Hoffnung“ zu sprechen. Einige meinten, eine „Kritik der Hoffnung“ sei notwendig, um vorschnelle Vertröstungen und das Abspeisen mit dem „kleinen Glück“ zu verhindern, die vor allem die Kirchen lange als Form des Missbrauchs von Hoffnung betrieben und damit Visionen verhindert hätten. Andere beschrieben Hoffnung als die lebensnotwendige Triebkraft, trotz allem weiter zu kämpfen.
Auch wenn es in unserer Diskussion dort um individuelle Hoffnung im Angesicht von Krankheit und Tod ging, erinnert es doch an die gegenwärtig herrschende Krisenbewältigungstaktik, die auch nach einer „Kritik der Hoffnung“ schreit: Das Versprechen – die schale Hoffnung –, mit kurzfristigen Konjunkturprogrammen sei lebenswertes Leben zu garantieren, gilt es als das zu entlarven, was sie ist: Verschleppung der realen Ausmaße der Krise und Ablenkung von der Notwendigkeit einer grundsätzlichen Umkehr – bis zur Bundestagswahl oder bis die Zusammenhänge, die Infragestellungen von Staat und Wirtschaft, die widersprüchlichen Versprechungen und die zynische Abkehr vom „Sozialstaat“ nicht mehr so offensichtlich sind und die vorhergesagten „Unruhen“ unwahrscheinlicher?
Im März demonstrierten wir mit Zehntausenden in Berlin und Frankfurt, in den Gewerkschaften regt sich Protest und auch neue Phantasie, z. B. in Form von Flashmobs im Einzelhandel: Teils zusammen mit Beschäftigten sabotieren AktivistInnen den Betriebsablauf, um Streikbrechen, z. B. durch das Anheuern von LeiharbeiterInnen, zu erschweren. Bis zu Generalstreiks, wie sie in Griechenland oder Frankreich stattfinden, scheint es allerdings ein weiter Weg – weiterhin haben Witze wie dieser ihre Berechtigung: „Manager im Betrieb einschließen? Das geht in Deutschland leider nicht: Das Gebäude ist als Gewerberaum gemeldet!“ Trotzdem ist zu hoffen, dass wider die schalen Hoffnungen auf kurzfristige „Erholung des Systems“ sich auch immer mehr Wut und Hoffnung im Sinn von Visionen einer anderen Gesellschaft Bahn brechen werden – im Sinn der zwei Schriftzeichen, die im Chinesischen das Wort „Krise“ bilden: „Gefahr“ und „günstiger Moment“.
1Herbert Steeg: Was sind die Bedingungen dieser Krise? Ein Versuch, den Kladderadatsch im Kreditsystem anders zu sehen, in: analyse & kritik 538, 17. April 2009, 32f., 33.
Walter Dirks zur Zukunft des Vaticanum II
Martin Ostermann
In einem Rückblick auf das II. Vatikanische Konzil schrieb Walter Dirks (1901-1991), bekannter Publizist und engagierter Katholik, unter dem Titel „Gehorsam und Aufbruch“: „Es wäre schlimm, wenn der Ertrag des II. Vaticanums in derselben Weise und in demselben Geiste als kodifiziert gälte, wie die Beschlüsse des Tridentinums und des I. Vaticanums… Es wäre erst recht schlimm, wenn der Geist, der in Rom so viele bewegt hat, nun gehindert würde, weiterhin die Herzen und Köpfe der ecclesia semper reformanda in Unruhe zu bringen“ (Die Autorität der Freiheit, Bd. III, 1967, S. 621). Beide Entwicklungen, die Mumifizierung der Verlautbarungen des Konzils und die Unterdrückung seines Geistes, sind nur allzu bald eingetreten und heute, 50 Jahre nach dem Anstoß Johannes XXIII., „die Fenster aufzureißen“ und „die reinen klaren Linien der Urkirche“ nachzuziehen, steht zur Entscheidung, ob der Aufbruch des II. Vaticanums einen Bruch mit dem Überkommenen und einen Neuanfang bedeutet, oder ob das, was damals geschah, nun kodifiziert und in den breiten Strom von kirchlichem Traditionalismus eingeordnet nur als solcher in der Gegenwart noch wirksam werden soll. Unmittelbar nach dem Konzil hatte schon Karl Barth, der bedeutendste evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts, die Auffassung vertreten, die Beschlüsse des II. Vaticanum seien gegenüber dem Tridentinum und dem I. Vaticanums ein deutlicher Bruch und ein Neuanfang (Ad limina apostolorum, 1967).
Das Konzil und Lateinamerika
An das Konzil zu erinnern und Wege zu erkunden, „die die Kirche in der Zukunft wird zurücklegen müssen, wenn sie dem Geist des Konzils treu bleiben will“ (Der unterbrochene Frühling, 2006, S.10), hatten sich im November 2005 Theologen aus Lateinamerika und Europa aus Anlass des 40. Jahrestages der Beendigung des II. Vatikanischen Konzils vorgenommen. Angesichts neoliberaler Globalisierung und ihrer zerstörerischen Folgen für das Leben auf der Erde und viele Menschen in den Ländern des Südens sowie einer mythenverdächtigen Wiederkehr der Religion, skizzierten sie Aufbrüche in eine hoffnungsvolle Zukunft.
Demgegenüber hat die Glaubenskongregation mit ausdrücklicher Billigung Benedikts XVI. am 11. Juli 2007 ihrerseits klar gemacht, wie das II. Vaticanum laut päpstlicher Weisung verstanden werden soll, und eine Erklärung vorgelegt (Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten der Lehre über die Kirche), die die Aufbrüche des Konzils beiseite schiebt und ein Kirchenverständnis propagiert, das der exklusiven Interpretation v o r dem II. Vaticanum entspricht. Für den regierenden Papst Benedikt XVI. scheint klar, dass in der gegenwärtigen Zivilisationskrise nur kirchlicher Traditionalismus einer überbordenden Moderne Paroli bieten kann. Die Wiedereinführung des tridentinischen Ritus als reguläre Form der liturgischen Feier, die Einsetzung der alten Karfeitagsfürbitte mit ihrem nur leicht modifizierten Gebet für die Juden und die Aufhebung der Exkommunikation der Bischöfe der Piusbruderschaft sind die in letzter Zeit öffentlich besonders registrierten Symptome für diese Orientierung des Papstes.
Traditionalismus und Ökumene
Die von Benedikt XVI. geübte Form von römischem Traditionalismus hatte schon Walter Dirks im Auge, als er folgende Überlegung formulierte: „Ein neuer Aufbruch im Pilgerweg sowohl des Einzelnen als auch der Kirche ist nicht Ungehorsam, sondern Gehorsam, aufmerksames Hören nämlich auf die Stimme dessen, der unsichtbar vorangeht und dem wir zugleich – in derselben Bewegung – entgegengehen“ (AdF III S.620).
Dirks unterstreicht, dass – anders als im vorkonziliaren offiziellen Katholizismus – das neue Verständnis des Glaubensgehorsams auch die großen historischen Ungehorsamen einbegreift, die hingerichteten Hus und Savonarola, die schismatischen Albigenser und Waldenser und viele andere. Über Luther schreibt er: „Man versteht, dass Martin Luther mindestens gehorsam sein wollte; ja alle vorurteilslosen Katholiken erkennen an, dass er mindestens zum Teil gehorsam war, als er zu einem neuen Verständnis des Glaubens und der Erlösung aufbrach.“ (AdF III, S. 620)
Autoritarismus und Befreiungstheologie
Dass Glaubensgehorsam nicht dasselbe ist wie Beugung unter kirchlichen Autoritarismus, konnte man in jüngster Zeit am Fall des Befreiungstheologen Jon Sobrino studieren, der ausgerechnet im Vorfeld der lateinamerikanischen Bischofskonferenz von Aparecida (März 2007) durch eine Notificatio der Glaubenskongregation (März 2007) zum Widerruf wichtiger Thesen seiner Christologie der Befreiung gezwungen werden sollte. In einem Brief an seinen Ordensoberen, Pater Kolvenbach, in dem er eine Unterschrift unter die Notificatio verweigerte, hat er öffentlich erklärt, dass die Glaubenskongregation ihn nicht nur übel ermahnt und bezichtigt, sondern der Vatikan schon früh in verschiedenen Diözesankurien und durch eine Reihe von Bischöfen ein Klima geschaffen hat, das sich gegen seine Theologie und die Befreiungstheologie überhaupt richtet. Die Linie, die Benedikt XVI. als Papst autoritativ durchzusetzen bestrebt ist, hatte er schon als Kardinal und Präfekt der Glaubenskongregation in vielfältigen Konflikten mit der Befreiungstheologie praktiziert: Befreiungstheologen, die mit den Armen lebten und arbeiteten, wurden an Traditionsmaßstäben einer eurozentristischen Theologie gemessen, die dem befreiungstheologischen Verständnis des Glaubensgehorsams schlechterdings nicht gerecht werden konnte (s. Konflikt um die Theologie der Befreiung, Diskussionen und Dokumente, hg. von N. Greinacher, 1985)
So zeigt sich heute in vielen Feldern, was Walter Dirks schon unmittelbar nach dem Konzil als entscheidende Frage der Zukunft vor Augen hatte: Wird es neue Aufbrüche im Gehorsam des Glaubens geben oder wird auoritativer kirchlicher Traditionalismus zur beherrschenden Macht? Auch am Umgang mit dem II. Vaticanum wird herauskommen, welchen Weg die Kirche in den vor uns liegenden Jahren gehen wird.
Literatur:
Walter Dirks, Die Autorität der Freiheit, 1967 – N. Greinacher, Konflikt über die Theologie der Befreiung 1985 – M. Ramminger u.a., Der unterbrochene Frühling, 2006
Die Tomate weiter werfen1 ….Feministische Gesellschaftskritik jenseits von Alphamädchen und F-Klasse
Sandra Lassak
Debatten um Familienpolitik, Kinderbetreuung, Elterngeld und Väterzeit ebenso wie der seit einiger Zeit in den Medien kursierende sogenannnte neue Feminismus scheinen auf den ersten Blick Diskussionen um Geschlechtergerechtigkeit wieder auf die politische Tagesordnung gebracht zu haben. So scheint der Feminismus in staatlichen Institutionen und in der bürgerlichen Mitte angekommen zu sein. Haben sich emanzipatorische Forderungen damit also erledigt?
Hervorgeholt aus der vermeintlichen Mottenkiste und befreit vom Mief der 70er Jahre soll Feminismus gerade für junge Frauen wieder attraktiv gemacht werden. Feminismus kann cool und lässig sein und soll das Leben schöner machen, so Meredith Haaf, Susanne Klinger und Barbara Streidl in ihrem Buch „Wir Alpha-Mädchen“. Thea Dorn propagiert in Abgrenzung vom Feminismus der 70er Jahre die neue F-Klasse, erfolgreiche Individualistinnen, die es geschafft haben, „ihre Projekte trotz Anfechtungen durchzusetzen und dennoch keine schmallippigen Karrieremaschinen geworden sind.“ Ebenso verabschieden sich die „neuen deutschen Mädchen“ Jana Hensel und Elisabeth Raether von einem Populär-Feminismus à la Alice Schwarzer und konzentrieren sich stattdessen in autobiografischer Weise auf das, was ihrer Auffassung nach der Feminismus außen vor gelassen hat: die Probleme, Wünsche und Sehnsüchte des privaten Lebens von Frauen. Doch was hat das tatsächlich mit feministischer Kritik an der gesamten Gesellschaft zu tun?
Feministische Leerstellen
Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass diese Art Post-Feminismus nichts gemeinsam hat mit einem gesellschaftskritischen Feminismus der sogenannten zweiten Frauenbewegung, die im Kontext der StudentInnenbewegung 1968 entstand. Als Teil sozialer Bewegungen und Kämpfe formulierte sie eine fundamentale Kritik an bestehenden kapitalistischen Verhältnissen. Die Perspektive der Generation der Alpha-Feministinnen ist jedoch eine andere. Ihnen geht es vor allem um sich selbst: Um mittelständische, intellektuelle Frauen auf der Karriereleiter steil nach oben. Ihr „feministischer“ Anspruch ist begrenzt auf individuelle Selbstverwirklichung und beruflichen Erfolg. Mag dieser Anspruch das Lebensgefühl einer bestimmten Gruppe von Frauen aufgreifen, angesichts der aktuellen sozialen und politischen Entwicklungen greift er jedenfalls viel zu kurz. Die Lebenssituation von Migrantinnen, Hartz IV-Empfängerinnen, Alleinerziehenden, um nur einige zu nennen, kommen nicht vor, geschweige denn, dass ein Blick über den eigenen bundesrepublikanischen Tellerrand hinaus gemacht wird. So scheint es der neuen feministischen Avantgarde noch nicht aufgefallen zu sein, dass globale (patriarchale) Unrechtsstrukturen besonders auch Frauen betreffen und unter den Frauen selbst große Ungleichheitsverhältnisse existieren.
Feministische Gesellschaftskritik jenseits von Alphamädchen….
Mit der Veranstaltungsreihe „Die Tomate weiter werfen….Feministische Gesellschaftskritik jenseits von Alphamädchen und F-Klasse“ diskutierten wir Notwendigkeiten und Möglichkeiten, in die aktuellen Debatten einzugreifen und jenseits von Alphamädchen und F-Klasse Fragen nach sexistischen und rassistischen Herrschaftsstrukturen zu stellen. Entgegen den herrschenden Individualisierungstendenzen und der verbreiteten Auffassung, dass jede ihres eigenen Glückes Schmiedin ist, ist es notwendig, wieder neue Bande der Solidarität zu knüpfen und Widerstandspraxen zu entwerfen. Wie können unterschiedlichste feministische Ansätze bündnisfähig werden sowohl untereinander, als auch mit anderen, z.B. globalisierungskritischen oder antirassistischen sozialen Bewegungen? An drei Abendveranstaltungen gingen wir diesen Fragen nach. Den Auftakt bildete der Film „Brot und Rosen“ von Ken Loach, der die Thematik illegalisierter Arbeitsmigration von Mittelamerika in die USA behandelt. Dabei ging es aber auch um Wünsche und Sehnsüchte nach einem besseren Leben und der Kraft gemeinsamen solidarischen Widerstands. Desweiteren setzten wir uns mit der Berliner Politologin Stefanie Ehmsen über die Entwicklungen der Frauenbewegungen seit 1968 und die zunehmende Institutionalisierung ihrer Forderungen durch „gender mainstreaming“ und staatliche Gleichstellungsprogramme auseinander. Den Abschluss der Reihe bildete ein Vortrag von Gabriele Winker vom Feministischen Institut in Hamburg über feministische Gesellschaftskritik in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise.
Wir hoffen, dass mit der Veranstaltungsreihe nicht nur Ansätze feministischer Gesellschaftskritik sichtbar wurden, sondern damit auch Impulse und Ideen angestoßen wurden, nach Handlungsmöglichkeiten feministischen Widerstands für eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft zu suchen.
1 Ein Tomatenwurf während der Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes war 1968 einer der Startschüsse für die zweite deutsche Frauenbewegung. Damals kritisierten die Studentinnen, der SDS ignoriere die Diskriminierung von Frauen.
Zwischen Medellín und Paris
Kuno Füssel/ Michael Ramminger
Uner diesem Titel ist gerade ein Buch in der edition ITP-Kompass erschienen, das sich mit 1968 und der Theologie beschäftigt. Wir dokumentieren das Vorwort:
In vielen Ländern Europas waren die öffentlichen Diskussionen über den Zustand der Welt, das Selbstverständnis der Gesellschaften und ihrer politischen Systeme in diesem Jahr vom Thema „1968“ bestimmt: Waren die damaligen Aufbrüche lediglich affektiv aufgeladener Ausdruck des Protestes gegen die bürgerliche Gesellschaft, der nicht nur politikfern, sondern sogar politikunfähig, gar politikverweigernd war? Oder hat die Bewegung zivilisatorische Implikationen gehabt, die in den gegenwärtigen Verhältnissen, den repräsentativen Demokratien, im europäischen Gedanken und in der Gestaltung der Globalisierung aufgehoben ist? Eine weitere Interpretationsmöglichkeit dagegen hat es bis heute schwer: Dass nämlich in den Aufbrüchen dieser Zeit etwas Unabgegoltenes liegt, dass wir dem „Projekt Menschheit“, um das es ging, nicht näher gekommen sind, sondern ganz im Gegenteil uns zunehmend von ihm entfernen – und die Herausforderungen deshalb nach wie vor Gültigkeit besitzen.
Die 68er-Bewegung war allerdings kein ausschließlich europäisches Phänomen, kein Phänomen von Paris, Berlin, Prag, Zürich und Turin, es war eine weltweite Bewegung: In Mexiko gab es den 123 Tage langen Streik der Universitäten und das Blutbad von Tlatelco, bei dem über 500 Studierende ermordet wurden: die „Studierenden wurden zu Sprechern des Volkes, des allgemeinen Bewußtsein“, wie Octavio Paz schrieb. In Brasilien wurden unter der Militärdiktatur am 13.12.1968 fast alle Bürgerrechte außer Kraft gesetzt, es gab Studentenunruhen und Streiks, Chile erlebte in den sechziger Jahren eine starke Politisierung und 1969 wurde die Unidad Popular gegründet. Der Freiheitskampf Vietnams spiegelte sich sowohl in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, der Ermordung Martin Luther Kings am 04. April 1968, in der Antikriegsbewegung und in Südafrika entstand die Black Consciousness Movement, die wiederum von der us-amerikanischen black power Bewegung inspiriert war. Auch in Japan kam es im Oktober 68 zu schweren Unruhen von Arbeitern und Studenten, die sich den us-amerikanischen Studenten und ihrem Aufruf gegen den Vietnam-Krieg angeschlossen hatten. Vierzig Jahre danach ist also vielerorts eine Interpretationsschlacht über die Bedeutung dieser Bewegungen und Aufbrüche entbrannt: Utopismus, gelungene Zivilisierung und Liberalisierung oder unabgegoltene Herausforderung?
Um so erstaunlicher ist, dass in diesen Diskussionen ein – zumindest in der damaligen Zeit – bedeutsamer gesellschaftlicher Akteur überhaupt nicht vorkommt: Die Kirchen und die ChristInnen. Denn 1968 war nicht nur eine Studentenbewegung, es ging nicht nur um Universitäten, Staat und Gesellschaft, sondern auch um Theologie und Kirche. 1968 fand die vierte Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen in Uppsala und die christliche Weltstudentenkonferenz in Turku statt, in der Bundesrepublik Deutschland das erste politische Nachtgebet, wenige Jahre später die erste ökumenische Frauenkonsultation des Weltrats der Kirchen. 1968 war das Jahr der „Option für die Armen“ bei der Vollversammlung des lateinamerikanischen Episkopats in Medellín, die Befreiungstheologie artikulierte sich, in der Bundesrepublik die politische Theologie und die Theologie der Hoffnung: Aufbrüche in Theologie und Kirchen und der Theologie und Kirchen in die Welt zeugen davon, dass die Ereignisse von ´68 – wie sollte es auch anders sein – auch ein Aufbruch der ChristInnen, Kirchen und der Theologie waren.
Die theologischen und kirchlichen Bewegungen dieser Zeit speisten sich aus zwei Erkenntnissen: dass sich das Christentum (und die Kirchen!), wenn es sich in dieser Welt legitimieren wollte, sich an seinen eigenen befreienden Traditionen orientieren musste, dass es um einen Gott geht, dessen „Ehre das Leben der Armen“ ist. Zum zweiten aus der Erkenntnis, dass sich eine solche Praxis an dem Niveau der Reflexionen über die bürgerliche Gesellschaft messen lassen muss. Fragen wie Eschatologie und Geschichte, die Grenzen aufgeklärter Vernunft und Theologie als Erinnerungs- und Hoffnungsgemeinschaft, das Verhältnis zum Marxismus, neue Formen der Bibelauslegung wie sozialgeschichtliche- und materialistische Bibelexegese, die Frage nach dem „Subjekt“ und damit nach dem Ort der Theologie, die Frage, wie überhaupt nach Auschwitz noch von Gott zu reden sei, und nicht zuletzt die Frage nach dem Zustand der Kirchen selbst wurden von „68“ angestoßen – und bleiben bis heute die drängenden Fragen.
Worin also ist der Grund dafür zu suchen, dass in den Kirchen weder eine Debatte über „68“ geführt wird, noch die Kirchen in den allgemeinen Debatten vorkommen?
Dazu müssten sicherlich zwei Fragen (kontextspezifisch) beantwortet werden: 1. Was ist in den Kirchen geschehen, dass diese Diskussion nicht geführt wird und 2. was mit den Kirchen geschehen ist, dass sie in diesem Kontext nicht diskussionswürdig erscheinen, offenkundig vernachlässigbar sind?
Im Rückblick scheint es so, als seien die Herausforderungen von „68“ von den Kirchen zuletzt doch erfolgreich abgeblockt worden. Was zugleich bedeutet, dass es trotz der aus den Kirchen selbst kommenden Reformbestrebungen ein institutionelles Beharrungsvermögen gab, sich mehr oder minder auf der Seite der Herrschenden zu halten, mindestens aber eine Äquidistanz zwischen ihnen und gesellschaftlichen Oppositionsgruppen zu wahren. Dieses Beharrungsvermögen wurde unterschiedlich abgesichert: Zum einen durch den aktiven Ausschluss links-christlicher Personen und Gruppen, mindestens ihre Marginalisierung, zum anderen durch eine Strategie der Kooptation kritischer Interventionen, die es natürlich in dem Maße einfach hatte, wie gesamtgesellschaftlich deren emanzipativen Anliegen an den Rand gedrängt wurden. Diese Prozesse vollzogen sich in den verschiedenen Kirchen und Kontexten natürlich ungleichzeitig. So gab es in den achtziger Jahren die große Konjunktur der Befreiungstheologie in Lateinamerika, während hier in Europa der links-christliche Flügel wie die ChristInnen für den Sozialismus oder die Bewegung der Arbeiterpriester (heute Arbeitergeschwister) im eh schon existierenden historisch breiten Graben zwischen Arbeiterbewegung und Kirche schon bald wieder ausgegrenzt und marginal waren. In den Kirchen gibt es also heute deshalb keine Diskussion über „68“, weil die meisten derjenigen, die biographisch oder politisch-theologisch in dieser Tradition stehen, in der Kirche „nichts zu sagen haben“ und es für alle anderen keine „gefährliche Erinnerung“ ist.
Bliebe die zweite Frage: Warum sind die Kirchen in der allgemeinen Diskussion um „68“ kein Thema wert? Nun, der Verdacht legt sich nahe, dass sie es eben nicht „wert“ sind. Was nichts anderes bedeutet, als dass wir heute möglicherweise in einer Situation stehen, in der es endgültig vorbei ist mit der bedeutsamen Funktion der großen Volkskirchen als formierten, gesellschaftspolitisch relevanten Akteuren. Längst haben sie möglicherweise ihre Bedeutung als herrschaftsstabilisierende Faktoren (Stichwort: bürgerliche Religion) an andere gesellschaftliche Institutionen und Diskurse abgeben müssen. Dies wiederum bedeutet zugleich, dass auch niemand mehr etwas von ihnen (weder positiv noch negativ) zu erwarten oder zu befürchten hat.
Das allerdings wäre eine tragische Ironie der Geschichte: Dass die Kirchen so auf den „vermeintlichen Feind von innen“ fokussiert waren, dass sie gar nicht bemerkt haben, wie ihnen vom globalen Kapitalismus die Funktion zu gemeinschaftsverpflichtender Normativität genommen wurde und in Werbung, Marketing, Eventorientierung ausgelagert wurde: Dorthin, worauf nur der Kapitalismus noch Zugriff hat.
Womit wir beim Anlass dieses Buches wären: dass es nämlich Grund genug gibt, an die Aufbrüche von „68“ zu erinnern, weil die Verhältnisse dies erfordern und es zugleich immer noch Menschen gibt, denen die Traditionen des Ersten und Zweiten Testamentes so wichtig sind, dass sie auf deren Aktualität beharren und aus ihnen eine Kriteriologie für die Beurteilung der herrschenden Verhältnisse ableiten. Dies ist keine Sentimentalität, keine Unverbesserlichkeit, sondern der Wirklichkeit selbst geschuldet: Nur um den Preis des Realitätsverlustes kann man nämlich heute behaupten, dass sich die Dinge in den letzten vierzig Jahren zum Besseren gewandt hätten. Neue Kriege, neuer Hunger, neue Arbeitslosigkeit oder fortschreitende Naturzerstörung bestimmen die Verhältnisse, wie ein Blick selbst in die offiziellen Statistiken nationaler Regierungen und internationaler Organisationen belegt.
Die Beiträge in diesem Buch sollen keine Lösungen für all diese Probleme vorlegen. Sie wollen zuallererst die Erinnerung daran freilegen, dass Theologie und Kirchen ihren besten Traditionen schon einmal mehr zugetraut haben, dass sie bereit waren, sich von ihren bürgerlichen und oligarchischen Fesseln zu lösen, um sich gegen die zu stellen, „in deren Häusern das geraubte Gut der Armen liegt“ und um mit denen zu sein, die in Mt 31 die Subjekte der Geschichte sind.