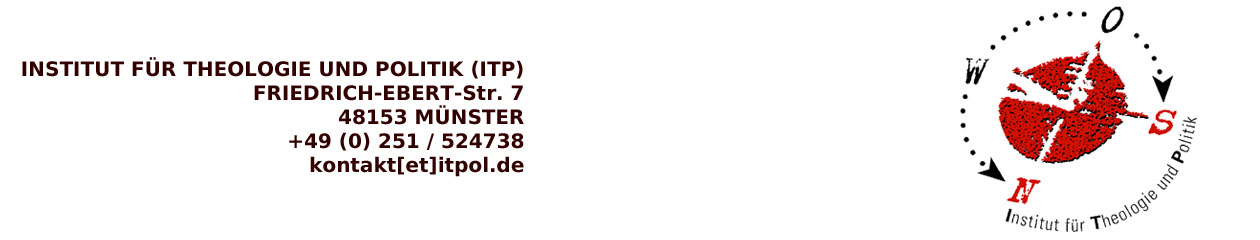editorial – Der Katakombenpakt – Sandra Lassak: Was macht uns krank? – Christine Berberich: Die Zeichen der Zeit. Eine Bibellektüre – Katja Strobel: „Kreuzungen“. Kirchen, die sich von der Realität in Frage stellen lassen? – Michael Ramminger: edition ITP-Kompass
editorial
Liebe Freunde,
auch in diesem Rundbrief fällt das Editorial zugunsten der Dokumentation eines Textes etwas kürzer aus. Norbert Arntz hat für uns einen bemerkenswerten Text katholischer Bischöfe aus der Zeit des II. Vatikanischen Konzils übersetzt. Vierzig Bischöfe waren damals gemeinsam den sogenannten „Katakombenpakt“ eingegangen, später schlossen sich weitere ca. 400 Bischöfe an. Einer der ersten Unterzeichner war der damalige Erzbischof von Recife, Dom Helder Camara. Stünde den Kirchen nicht auch heute ein solch deutliches Wort angesichts der politisch-ökonomischen Verhältnisse an?
Ansonsten finden Sie in unserem Rundbrief wieder einen Querschnitt mit Berichten und Überlegungen aus unserer Arbeit. Wir bedanken uns damit bei allen, die uns unterstützen, ganz herzlich, und wünschen Euch und Ihnen ruhige Tage über den Jahreswechsel – und für das neue Jahr Kraft, innere Ruhe und Entschiedenheit in der Hoffnung dessen, was da kommen soll und an dem wir durch unser Tun Anteil haben können.
Ihr ITP-Team
Der Katakombenpakt
Als Bischöfe,
• die sich zum Zweiten Vatikanischen Konzil versammelt haben;
• die sich dessen bewusst geworden sind, wieviel ihnen noch fehlt, um ein dem Evangelium entsprechendes Leben in Armut zu führen;
• die sich gegenseitig darin bestärkt haben, gemeinsam zu handeln, um Eigenbrötelei und Selbstgerechtigkeit zu vermeiden;
• die sich eins wissen mit all ihren Brüdern im
Bischofsamt;
• die vor allem aber darauf vertrauen, durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sowie durch das Gebet der Gläubigen und Priester unserer Diözesen bestärkt zu werden;
• die in Denken und Beten vor die Heilige Dreifaltigkeit, vor die Kirche Christi, vor die Priester und Gläubigen unserer Diözesen hintreten;
nehmen wir in Demut und der eigenen Schwachheit bewusst, aber auch mit aller Entschiedenheit und all der Kraft, die Gottes Gnade uns zukommen lassen will, die folgenden Verpflichtungen auf uns:
1. Wir werden uns bemühen, so zu leben, wie die Menschen um uns her üblicherweise leben, im Hinblick auf Wohnung, Essen, Verkehrsmittel und allem, was sich daraus ergibt (vgl. Mt 5,3; 6,33-34; 8,20).
2. Wir verzichten ein für allemal darauf, als Reiche zu erscheinen wie auch wirklich reich zu sein, insbesondere in unserer Amtskleidung (teure Stoffe, auffallende Farben) und in unseren Amtsinsignien, die nicht aus kostbarem Metall – weder Gold noch Silber – gemacht sein dürfen, sondern wahrhaft und wirklich dem Evangelium entsprechen müssen (Vgl. Mk 6,9; Mt 10,9; Apg 3,6).
3. Wir werden weder Immobilien oder Mobiliar besitzen noch mit eigenem Namen über Bankkonten verfügen; und alles, was an Besitz notwendig sein sollte, auf den Namen der Diözese bzw. der sozialen oder caritativen Werke überschreiben (vgl. Mt 6,19-21; Lk 12,33-34).
4. Wir werden, wann immer dies möglich ist, die Finanz- und Vermögensverwaltung unserer Diözesen in die Hände einer Kommission von Laien legen, die sich ihrer apostolischen Sendung bewusst und fachkundig sind, damit wir Apostel und Hirten statt Verwalter sein können (vgl. Mt 10,8; Apg. 6,1-7).
5. Wir lehnen es ab, mündlich oder schriftlich mit Titeln oder Bezeichnungen angesprochen zu werden, in denen gesellschaftliche Bedeutung oder Macht zum Ausdruck gebracht werden (Eminenz, Exzellenz, Monsignore). Stattdessen wollen wir als „Padre“ angesprochen werden, eine Bezeichnung, die dem Evangelium entspricht.
6. Wir werden in unserem Verhalten und in unseren gesellschaftlichen Beziehungen jeden Eindruck vermeiden, der den Anschein erwecken könnte, wir würden Reiche und Mächtige privilegiert, vorrangig oder bevorzugt behandeln (z.B. bei Gottesdiensten und bei gesellschaftlichen Zusammenkünften, als Gäste oder Gastgeber) (Lk 13,12-14; 1 Kor 9,14-19).
7. Ebenso werden wir es vermeiden, irgendjemandes Eitelkeit zu schmeicheln oder ihr gar Vorschub zu leisten, wenn es darum geht, für Spenden zu danken, um Spenden zu bitten oder aus irgendeinem anderen Grund. Wir werden unsere Gläubigen darum bitten, ihre Spendengaben als üblichen Bestandteil in Gottesdienst, Apostolat und sozialer Tätigkeit anzusehen (Vgl. Mt 6,2-4; Lk 15,9-13; 2 Kor 12,4).
8. Für den apostolisch-pastoralen Dienst an den wirtschaftlich Bedrängten, Benachteiligten oder Unterentwickelten, werden wir alles zu Verfügung stellen, was notwendig ist an Zeit, Gedanken und Überlegungen, Mitempfinden oder materiellen Mitteln, ohne dadurch anderen Menschen und Gruppen in der Diözese zu schaden. Alle Laien, Ordensleute, Diakone und Priester, die der Herr dazu ruft, ihr Leben und ihre Arbeit mit den Armgehaltenen und Arbeitern zu teilen und so das Evangelium zu verkünden, werden wir unterstützen (vgl. Lk 4,18f.; Mk 6,4; Mt 11,45; Apg 18,3-4; 20,33-35; 1 Kor 4,12; 9,1-27).
9. Im Bewusstsein der Verpflichtung zu Gerechtigkeit und Liebe sowie ihres Zusammenhangs werden wir daran gehen, die Werke der „Wohltätigkeit“ in soziale Werke umzuwandeln, die sich auf Gerechtigkeit und Liebe gründen und alle Frauen und Männer gleichermaßen im Blick haben. Damit wollen wir den zuständigen staatlichen Stellen einen bescheidenen Dienst erweisen (vgl. Mt 25,31-46; Lk 13,12-14 und 33f).
10. Wir werden alles dafür tun, dass die Verantwortlichen unserer Regierung und unserer öffentlichen Dienste solche Gesetze, Strukturen und gesellschaftlichen Institutionen schaffen und wirksam werden lassen, die für Gerechtigkeit, Gleichheit und gesamtmenschliche harmonische Entwicklung jedes Menschen und aller Menschen notwendig sind. Dadurch soll eine neue Gesellschaftsordnung entstehen, die der Würde der Menschen- und Gotteskinder entspricht (vgl. Apg 2,44f; 4,32-35; 5,4; 2 Kor 8 und 9; 1 Tim 5,16).
11. Weil die Kollegialität der Bischöfe dann dem Evangelium am besten entspricht, wenn sie sich gemeinschaftlich im Dienst an der Mehrheit der Menschen – zwei Drittel der Menschheit – verwirklicht, die körperlich, kulturell und moralisch im Elend leben, verpflichten wir uns:
• gemeinsam mit den Episkopaten der armen Nationen dringliche Projekte zu verwirklichen, entsprechend unseren Möglichkeiten.
• auch auf der Ebene der internationalen Organisationen das Evangelium zu bezeugen, wie es Papst Paul VI. vor den Vereinten Nationen tat, und gemeinsam dafür einzutreten, dass wirtschaftliche und kulturelle Strukturen geschaffen werden, die der verarmten Mehrheit der Menschen einen Ausweg aus dem Elend ermöglichen, statt in einer immer reicher werdenden Welt ganze Nationen verarmen zu lassen.
12. In pastoraler Liebe verpflichten wir uns, das Leben mit unseren Geschwistern in Christus zu teilen, mit allen Priestern, Ordensleuten und Laien, damit unser Amt ein wirklicher Dienst werde. In diesem Sinne werden wir
• gemeinsam mit ihnen „unser Leben ständig kritisch prüfen“;
• sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, so dass wir vom Heiligen Geist inspirierte Animateure werden, statt Chefs nach Art dieser Welt zu sein;
• uns darum mühen, menschlich präsent, offen und zugänglich zu werden.
• uns allen Menschen gegenüber offen erweisen, gleich welcher Religion sie sein mögen (vgl. Mk 8,34f.; Apg 6,1-7; 1 Tim 3,8-10.
13. Nach der Rückkehr in unsere Diözesen werden wir unseren Diözesanen diese Verpflichtungen bekanntmachen und sie darum bitten, uns durch ihr Verständnis, ihre Mitarbeit und ihr Gebet behilflich zu sein.
Gott helfe uns, unseren Vorsätzen treu zu bleiben.
Übersetzung: Norbert Arntz
Was macht uns krank – Globale soziale Rechte und aktivierende Befragungen
Sandra Lassak
Im Zuge der G8-Protestaktionen 2007, an denen auch das ITP beteiligt war, hat sich eine Initiative aus verschiedenen NGOs wie medico international, kein mensch ist illegal, attac Deutschland, Gewerkschaftsmitgliedern u.a. unter dem Leitbegriff „Globale Soziale Rechte“ (GSR) gebildet. Bei Globalen Sozialen Rechten handelt es sich um grundlegende Menschenrechte wie Gesundheit, Nahrung, Bildung, Mindesteinkommen etc. Im Unterschied zu Menschenrechten, die zwar in vielen staatlichen Gesetzen und suprastaatlichen Konventionen verankert sind, wodurch aber ihre Umsetzung noch lange nicht garantiert ist, wird die Forderung nach globalen sozialen Rechten sozusagen „von unten“ angestoßen.
Globale Soziale Rechte meinen ein politisches Emanzipationsprojekt, das Partizipation und Selbstbestimmung ermöglicht. Ziel der Initiative „Globale Soziale Rechte“ in der BRD ist auch, die verschiedenen Gruppen und ihre konkreten Anliegen zusammenzubringen und so Verbindungen beispielsweise zwischen ArbeiterInnen und MigrantInnen, Studierenden und SeniorInnen sowie Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit herzustellen und ihren globalen Zusammenhang sichtbar zu machen. Dabei geht es auch um strategische Überlegungen, die zu politischer Organisierung und Aktion führen sollen.
Verstand sich die GSR-Initiative zunächst als eine Plattform, um spektrenübergreifende Debatten und Diskussionen anzustoßen, so sollte eine Untersuchung im Feld der Gesundheit unter der Fragestellung „Was macht uns krank?“ Reflexionen zu Globalen Sozialen Rechten in den Alltagserfahrungen verankern.
Ein solcher Erfahrungsaustausch über das Alltagsleben, die Erfahrungen in der Arbeit sowie im individuellen und kollektiven sozialen Leben soll Gemeinsamkeiten deutlich machen, „Wut und Mut“ erzeugen und zu gemeinsamem politischen Handeln führen. Die dazu gewählte Methode der aktivierenden Befragung oder auch militanten Untersuchung geht auf Erfahrungen aus der Arbeiterbewegung in Italien Ende der 1950er Jahre zurück.
Die Methode der aktivierenden Befragung wurde zu Beginn der Jahrtausendwende genutzt, lokale Erfahrungen in einen Zusammenhang mit internationalen Entwicklungen zu stellen. Erste Erfahrungen wurden damit in Brasilien gemacht, an die sich bald darauf auch Betriebe in anderen Ländern anschlossen, z.B. Mozambique und Mexiko.
Betriebe und Unternehmen
Die „aktivierenden Befragungen“ in Betrieben und Unternehmen waren ein bis dahin für gewerkschaftliche Arbeit ungewöhnlicher Ansatz: Sprechen über das eigene Leben und die persönlichen Erfahrungen als Ausgangspunkt der Kritik an den bestehenden Verhältnissen, um dabei zu erkennen, dass vermeintlich individuelle Leiden Teil eines kollektiven Problems sind. Mit dieser Methode veränderte sich nicht nur die Art und Weise bisheriger Interessenvertretungspolitik, sondern dadurch wurden auch Politisierungsprozesse unter den Beteiligten in Gang gesetzt. Als positive Erfolge konnten vor allem konkrete Veränderungen auf lokaler Ebene, d.h. verbesserte Arbeitsbedingungen oder Versorgungsleistungen verzeichnet werden. Dabei zeigte sich jedoch auch, dass es zu einer dauerhaften Veränderung gewerkschaftlicher Praxis langer und schwer messbarer Prozesse bedarf. Seit Beginn des Projektes im Jahr 2001 bis heute haben mittlerweile mehr als 10.000 Beschäftigte in Brasilien an den Befragungen teilgenommen. Heute wird der Prozess von 300 MultiplikatorIinnen aus 16 Einzelgewerkschaften koordiniert.
Zielgruppen des aktuellen Projekts „aktivierender Befragungen“, die in sieben Städten der BRD durchgeführt werden, sind Flüchtlingsfrauen, Studierende, LehrerInnen, SeniorInnen in einem Wohnheim und Angestellte einer Klinik. In Münster beteiligten wir uns mit einer Gruppe von LehrerInnen an dem bundesweiten Projekt. In dem Projekt geht es vor allem um Empowerment und Politisierung.
Erfahrungen mit LehrerInnen in Münster
Mit einer Gruppe von elf LehrerInnen gingen wir im Rahmen eines Tagesseminars der Frage nach „Was macht uns krank?“. Durch den Einstieg über das Körpermapping (große Körperbilder) wurden Schmerzpunkte, die den beruflichen Alltag prägen, ausfindig gemacht. Stress, Ängste und Isolation äußern sich vor allem in Kopf-, Ohren- und Magenschmerzen sowie Rückenleiden. Sehr schnell wurde auf dieser Basis in einem zweiten Schritt auch der Zusammenhang zu strukturellen Ursachen hergestellt. Als wesentlicher „Krankmacher“ wurde die zunehmende Ökonomisierung des Bildungssektors und damit auch der Schule benannt. Dies äußert sich in ansteigendem Leistungsdruck sowie der Normierung und Kontrolle von Wissen durch Instrumente wie Lernstandserhebungen und digitalisierten Notengebungssystemen. Bildung ist so zum Wissensmanagement geworden. Die Ökonomisierung und der von oben ausgeübte Druck wirken sich nicht nur auf die Lehrenden aus und bestimmen ihr Verhältnis zu den SchülerInnen, sondern auch innerhalb der Schülerschaft verändern diese Entwicklungen die Beziehungen untereinander. „Bereits in der Ausbildung wird man für dieses System zugerichtet, um andere zuzurichten“, beschreibt eine Teilnehmerin diese Situation. Der „erlernte“ Leistungsdruck wird wiederum an SchülerInnen weitergegeben. Die Angst vor dem Versagen im System, keinen Arbeitsplatz zu bekommen, verstärkt Leistungsdruck und Kompetenzgerangel unter den SchülerInnen.
Und so werden die Erfahrungen des Schulalltags von den LehrerInnen als ständiges Aushalten von Widersprüchlichkeiten beschrieben: „Der permanente Zwang des Beurteilens und Selektierens erfordert, eigene Grundsätze und Überzeugungen beim Betreten der Schule weitestgehend vor der Tür zu lassen und Ansprüche, die nicht die eigenen sind, zu erfüllen.“
Isolation und EinzelkämpferInnentum gehören somit für viele zu den alltäglichen Erfahrungen. Während zwar einige TeilnehmerInnen auch von positiven Beispielen der Bündnisbildung gegen Druck und zunehmende Ökonomisierung innerhalb des Kollegiums berichteten, so bleibt für die meisten vor allem der eigene Unterricht als hauptsächlicher Ort subversiver politisierender Handlungsmöglichkeiten und Einflussnahme innerhalb des Systems Schule.
Dabei wird besonders dem Religionsunterricht, der innerhalb des schulischen Fächerkanons tendenziell weniger als andere Fächer dem Druck von Lehrplänen und Leistungszielen ausgesetzt ist, ein Potenzial an alternativen inhaltlichen und methodischen Gestaltungsfreiheiten zugesprochen.
Es gibt kein richtiges Leben im falschen
Angesichts dieser Situation war man sich innerhalb der Gruppe der Befragten ziemlich schnell darüber einig, dass institutionelle politische und ökonomische Veränderungen gefragt sind, um ein Umsteuern im System Schule überhaupt möglich zu machen. Es muss um einen anderen Begriff von Bildung gehen, als ihn die herrschende neoliberale Ideologie vorgibt. Anstelle eines Bildungsbegriffs, der sich wesentlich als Erwerb von Kompetenzen gemäß den Erfordernissen des Marktes versteht, ist ein Verständnis von Bildung gefragt, das in der Lebenswelt der SchülerInnen ansetzt, diese als denkende und handelnde Subjekte begreift und sie zu ProtagonistInnen im Bildungsprozess werden lässt.
Zweifache Blicke
Um die individuelle Flucht in die „subversive Nische“ des eigenen Unterrichts zu vermeiden bzw. andere Orte politischer Handlungsfähigkeit zu erschließen, nahmen die TeilnehmerInnen als bleibende Herausforderung den sogenannten „zweifachen Blick“ mit. Das heißt, das individuelle Befinden, die Grenzen und Möglichkeiten des Unterrichts immer in Verbindung mit seinem gesellschaftlichen Zusammenhang, durch den es bedingt ist, zu sehen. Aus dieser Perspektive lassen sich auch in Schulen Orte und Handlungsfelder gesellschaftsverändernder Praxis erschließen. Durch die aktivierende Befragung wurde nicht nur die Notwendigkeit deutlich, sich zukünftig weiterhin mit der Frage nach den eigenen Lebens- und Arbeitsbedingungen, krankmachenden Strukturen und Wegen des Gesundwerdens im Kreis der sich zweimal jährlich treffenden ReligionslehrerInnen auseinanderzusetzen, sondern einige waren auch motiviert, die Methode der aktivierenden Befragung an ihren Schulen, mit den KollegInnen oder auch mit SchülerInnen durchzuführen.
Zusammenfassend wurde der Austausch, den die aktivierende Befragung unter den LehrerInnen ermöglichte, als „ermächtigend“ erfahren und als ein Schritt auf der Suche nach Strategien zur „Gesundwerdung“ bewertet.
Im Rahmen des bundesweiten GSR-Projektes sollen noch weitere Befragungen durchgeführt werden, da die bisherigen Ergebnisse für eine Analyse gesellschaftlicher Krankheitszustände auf breiter Basis noch nicht ausreichen. Darüber hinaus wurde besonders in den medizinischen Flüchtlingshilfen eine Kampagne des „anonymen Krankenscheins“, der Illegalisierten einen Zugang zur medizinischen Versorgung ermöglichen soll, entwickelt, um so das Projekt GSR in verschiedenen Richtungen weiterzubringen.
Die Zeichen der Zeit und das Prinzip des „Weiter so“ – Eine Bibellektüre
Christine Berberich
Seit vielen Jahren findet in Münster regelmäßig ein- bis zweimal jährlich ein Lehrhaus statt. Ziel gemeinsamer Bibellektüre ist es, die Texte auf unsere heutigen Fragestellungen hin neu zum Sprechen zu bringen. Dass dabei immer wieder eine erstaunliche Aktualität zutage tritt, zeigt ein Beispiel aus dem Lehrhaus vom April dieses Jahres, das von dem Exegeten Dr. Andreas Bedenbender vorbereitet wurde. Dabei ging es unter anderem um das „Opfer der Witwe“ nach Mk 12,41–44.
Mit dieser Abgrenzung des Textabschnitts in den gängigen Bibelübersetzungen und der kirchlichen Leseordnung beginnt bereits das Problem, denn er entfaltet seinen Sinn innerhalb des Markustextes erst im Zusammenhang mit den vorausgehenden und nachfolgenden Sätzen, und dies wiederum im Rahmen der Jerusalem-Ereignisse insgesamt. Welche/r kirchlich sozialisierte Christ/in hätte nicht schon einmal eine Predigt gehört, in der das Verhalten der Witwe, die ihren gesamten Lebensunterhalt dem Tempel opfert, als leuchtendes Vorbild für „christliche Opferbereitschaft“ dargestellt wurde? Liest man dagegen, wie von Bedenbender vorgeschlagen, Mk 12,38–13,2 als eine Erzähleinheit, ergibt sich ein anderes Bild:
Jesus, der gerade den etablierten Schriftgelehrten vorgeworfen hat, dass sie „die Häuser der Witwen auffressen“ (12,40), kündigt unmittelbar nach der Opfer-Szene den Jüngern die Zerstörung des Tempels an (13,1f). Sein Kommentar zum Handeln der Witwe ist weder Lob noch Kritik, sondern nüchterne Analyse: Die Frau, die auch stellvertretend für das verarmte Volk gesehen werden kann, setzt offensichtlich ihre Heilshoffnung in solchem Ausmaß auf den Tempel, dass sie das letzte Geld, das ihr zum Leben geblieben ist, für diese Institution abgibt.
Religion und Ökonomie
Um die Bedeutung dieser Analyse in ihrer Tragweite einordnen zu können, hilft nochmals der Blick auf den größeren Erzählzusammenhang. Der Episode ging bereits die sogenannte Tempelreinigung voraus, bei der Jesus den Zustand des Tempels mit seinem Geld- und Opferbetrieb als „Räuberhöhle“ bezeichnete (11,15–19). Es folgen harte verbale Auseinandersetzungen mit der religiösen Führungsschicht, von denen zum Verständnis der fraglichen Stelle besonders zwei wichtig sind: zunächst Jesu Antwort auf die Frage nach der kaiserlichen Steuer, in Bedenbenders Übersetzung „gebt dem Kaiser zurück, was des Kaisers ist“ (12,17). Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Kritik des Markus an der Geldökonomie – wo immer in diesem Evangelium von Geld die Rede ist, laufen die Dinge gründlich schief – kann dies durchaus als Aufforderung verstanden werden, aus dem römischen Marktgeschehen auszusteigen. Der zweite Aspekt wird im Dialog mit einem verständigen Schriftgelehrten über das wichtigste Gebot (12,28–34) deutlich: Gottes- und Nächstenliebe müssen zusammengehalten werden, eine Opferpraxis auf Kosten der Armen ist falsch verstandene „Gottesliebe“.
Worauf richtet sich die Hoffnung der Armen?
Dass Jesus nun die Zerstörung der prächtigen Tempelbauten ankündigt, nachdem er das Verhalten der armen Witwe beobachtet hat, ist in der markinischen Erzählkonstruktion kein Zufall. Bedenbender sieht in dieser Episode den Wendepunkt der gesamten Erzählung: Wurde bisher gesagt, dass Jesus im Tempel durch die Unterstützung der Volksmenge geschützt war, so gibt er diesen Ort nun auf. Nach dem Erfolg der Reich-Gottes-Verkündigung beim einfachen Volk und der aktiven Auseinandersetzung mit den religiösen Führern ist nun die Endzeit-Rede (13,3–37) die letzte, nur noch an den engeren Jüngerkreis gerichtete Lehräußerung Jesu, bevor die Erzählung in die Passionsgeschichte übergeht.
Warum aber ausgerechnet an dieser Stelle? Einen Anhaltspunkt bietet die bereits erwähnte Eigenart des Evangelisten, die Frauen in der Erzählung auch als Repräsentantinnen eines Kollektivs einzusetzen: in diesem Fall die opfernde Witwe als symptomatisch für das Verhalten des armen Volkes, das sich, verblendet von der religiösen Führung, mit seiner Hoffnung auf Rettung weiterhin an den Tempel klammert, obwohl dieser längst selbst zu einem Element jenes Systems geworden ist, das seine Not verursacht. Flavius Josephus (BJ 6,5,2) berichtet, dass bei der Eroberung Jerusalems durch die Römer fast 6000 Menschen in dem von den Soldaten angezündeten Tempel verbrannten, weil sie sich in der Hoffnung auf ein rettendes Eingreifen Gottes dort versammelt hatten. Möglicherweise nimmt die Aufforderung in der Endzeitrede, in die Berge zu fliehen (13,14), auf diese Tragödie Bezug.
Messianische Wechselwirkungen
Nun ist für das Markusevangelium charakteristisch, dass das messianische Wirken Jesu von der Mitwirkung des Volkes abhängig ist. Nicht nur wird gegenüber den Menschen, die Jesus heilt, immer wieder betont, dass ihr Glaube ihnen geholfen hat, der Unglaube wird auch ausdrücklich als Hinderungsgrund für die den Anbruch des Gottesreiches anzeigenden Wundertaten des Messias genannt (6,5): Wo die Armen ihr Heil vom Tempel erhoffen, obwohl dieser wesentlich zu ihrer Unheilssituation beiträgt, besteht in der markinischen Logik keine Hoffnung mehr auf einen „Erfolg“ des Messias im Sinne einer grundlegenden Umkehr der Volksmehrheit.
Der weitere Verlauf der Erzählung bestätigt diese Sichtweise. Jesus zieht sich nach Betanien (Haus des Armen) in das „Haus Simons des Aussätzigen“ zurück – und von diesem Aussätzigen wird keine Heilung mehr berichtet. Wo dem Messias die Unterstützung des Volkes fehlt, kann er nicht mehr heilen, sondern begibt sich selbst ganz in die Sphäre der Ohnmacht und des Ausschlusses. Noch einmal tritt hier eine Frau auf, die gleichzeitig für eine kollektive Größe steht: Zion, die ihren Messias salbt und zu deren Gedächtnis Jesus auffordert. Mit ihrer Zeichenhandlung der Salbung scheint sie ihn zum messianischen Handeln provozieren zu wollen, er jedoch deutet das Symbol um zur Salbung für sein Begräbnis.
Trotz der hoffnungsvollen Anfänge läuft das öffentliche Wirken Jesu in der Konfrontation mit den herrschenden Mächten auf seinen Tod hinaus. Die Entscheidung schien jedoch bis zu dem Punkt offen, an dem sich – in der Erzählung exemplarisch am Opfer der Witwe – das religiös verblendete Festhalten des Volkes an der Institution Tempel zeigt. Angesichts der kirchlichen Rezeptionsgeschichte muss hier noch eigens darauf hingewiesen werden, dass es Markus dabei in keiner Weise um eine Polarisierung gegen das Judentum geht, es handelt sich vielmehr um die im jüdischen Glauben selbst begründete Kritik an einer Form von Religiosität, die nicht mehr dem Glauben an den befreienden Gott Israels entspricht, sondern im Gegenteil zur Stabilisierung des die Menschen unterdrückenden Herrschaftssystems beiträgt. Wo dies nicht durchschaut und überwunden wird, kann der Messias nicht so kommen wie erwartet – die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend umgestaltend –, sondern ein Neuanfang ist erst nach der Katastrophe, dem vollständigen Zusammenbruch möglich, wie es Jesus in der unmittelbar auf das „Opfer der Witwe“ folgenden „Endzeitrede“ ankündigt und wie Markus es von Jesu Tod und Auferweckung selbst erzählt.
Und der aktuelle Bezug? Albert Einstein wird die Feststellung zugeschrieben, dass man Probleme nicht mit der Denkweise lösen kann, die zu ihnen geführt hat. Aber die Tendenz, mehrheitlich selbst da, wo die Entwicklung eines etablierten Systems deutlich als katastrophale Sackgasse erkennbar wird, statt mit der notwendigen Umkehr mit einem „Mehr des Gleichen“ zu reagieren, scheint ein bleibendes Menschheitsproblem zu sein. Gerade der Umgang mit der jüngsten Krisensituation, das gläubige Setzen auf den „Heilsweg“ Wachstum, Konkurrenz und Privatisierung der Lebensrisiken, bestätigt diesen verhängnisvollen Mechanismus erneut, wofür das Wahlverhalten in Deutschland nur ein weiteres Beispiel ist. Um so dringlicher stellt sich die Frage, ob es immer wieder neu zur größtmöglichen Katastrophe kommen muss, oder ob die „gefährliche Erinnerung“, die unserem Glauben zugrundeliegt, als ein rettendes Wissen vermittelt werden kann, das Umdenken und neues Handeln ermöglicht.
„Kreuzungen“ – Kirchen, die sich von der Realität in Frage stellen lassen?
Katja Strobel
Vom 7. bis 9. Oktober fand in Münster, organisiert vom Missionswissenschaftlichen Institut unter Beteiligung des ITP, der Kongress „Crossroads – Christentümer in Bewegungen und Begegnungen“ statt. In Vorträgen und Workshops befassten sich die Teilnehmenden mit verschiedensten Perspektiven auf die Themen Migration, Weltkirche, Ökumene, interkulturelles Lernen, soziale Bewegungen – und mit ihren ‘Kreuzungen’.
Eine der zentralen aktuellen Herausforderungen für unseren Kontext wurde dem Kongress programmatisch vorangestellt: Christentümer müssen sich an der Realität messen lassen, z.B. dem Tod von jährlich Hunderten von Flüchtlingen an den europäischen Außengrenzen. In den Vorträgen aus dem deutschen Kontext benannte – bezeichnenderweise – nur Peter Arthur aus Ghana, der als Pastor in einer internationalen christlichen Gemeinde in Berlin tätig ist, diese Realität und wie die Schicksale der Flüchtlinge seinen Alltag als Pastor prägen. Dazu gehörte auch die bewusste Distanzierung von den Versuchen ‘deutscher’ Gemeinden, mit EinwanderInnen-Gemeinden in Kontakt zu kommen. Auf ‘deutscher’ Seite wird die de facto ungleiche Situation gern ignoriert: Man möchte sich über ‘Glauben’ austauschen, ohne sich mit den gravierenden sozialen, politischen und ökonomischen Unterschieden der Beteiligten auseinanderzusetzen. Oder, wenn dies doch der Fall ist, treten ‘deutsche’ Gemeinden und Gemeindemitglieder lediglich als Helfende auf und verschärfen damit die Ungleichheiten noch mehr. Peter Arthur setzte sich vehement dafür ein, dass z.B. der Kampf um politische und soziale Teilhaberechte von EinwanderInnen für eine mehr gleichberechtigte Position hilfreich wäre. Konsequent wäre, die Aktivitäten deutscher Gemeinden, die Kontakt zu MigrantInnen(-Gemeinden) suchen, genau in dieser Richtung zu betreiben. Evt. wäre dies ein ‘Glaubensaustausch’ in der Form von Taten, die mehr diesen Namen verdienten als gelegentliche Versuche, gemeinsam Gottesdienst zu feiern.
In den Workshops fand sich die unmenschliche Einwanderungsverhinderungspolitik Deutschlands und der EU allerdings durchaus als ein Schwerpunktthema wieder; z.B. wurde mit Vertretern christlicher und nicht-christlicher Initiativen, die Flüchtlinge beraten, mit ihnen zusammen leben und sich für Bleiberecht und Asyl einsetzen, diskutiert, wie Kirchengemeinden und christliche Gruppen sich zu dieser Realität verhalten. Die Ratlosigkeit und auch Ferne vieler teilnehmender Gemeinde- und Ordensleute von diesen Bewegungen und ihre Unwissenheit über deutsche bzw. europäische Migrationspolitik traten dabei offen zu Tage.
In der Abschlussdiskussion wurde noch einmal ganz klar benannt, was das Kernproblem dabei ist: ChristInnen müssen sich fragen, was ihre Position in der eigenen Gesellschaft ist, erst daran erweist sich ChristIn-Sein. Beim Thema Migration heißt die Frage: Verteidige ich das Recht, dass jedeR dort leben darf, wo er/sie will, nicht nur in der gelegentlichen ‘Begegnung’ mit MigrantInnen, sondern politisch? Mit welcher Rechtfertigung lebe ich in einer Gesellschaft, die täglich Menschen an ihren Grenzen ermordet?
Das Risiko eingehen: Das Kriterium des guten Lebens für alle ernst nehmen
Die provozierendsten Thesen für notwendige Veränderungen in den Kirchen formulierten Alberto da Silva Moreira und Nancy Cardoso Pereira aus Brasilien:
Alberto Moreira da Silva benannte die Position der katholischen Kirche am Scheideweg vor den beiden großen Herausforderungen des religiösen Pluralismus der Religionen und der Tatsache, dass die Religion aus den Kirchen auswandert und andere Institutionen Aufgaben der Kirchen übernehmen:
Erstens: Die Wahrheitsfrage muss weiterhin gestellt werden. Auch wenn es viele Wege zu Gott gibt, muss es trotzdem die evangelische Anstrengung geben, den besten Weg zu finden und zu suchen. Das Urteil darüber liegt aber bei den anderen: „An den Früchten erkennt ihr den Baum!“
Zweitens: Das destruktive Potential von Religion darf nie unterschätzt werden, vor allem wenn Marketing aufgegriffen und benutzt wird. Religiöser Pluralismus darf nicht im Relativismus enden: Ökumene entsteht aus der Nähe zur Gefahr, zur Bedrohtheit: Die gemeinsame Frage muss sein: Stehen wir dafür ein, dass Gottes Gerechtigkeit vor jeder Religion und Kirche im Mittelpunkt steht?
Drittens: In einer Kirche ‘von den Marginalisierten’ aus muss das konziliare Prinzip, muss Demokratie immer wieder eingefordert werden. Es geht in den Kirchen um nichts weniger als um ein solidarisches Ringen darum, wie die Welt von heute auszusehen hat.
Autonomie und kritische Partizipation
Nancy Cardoso Pereira forderte feministisch bewusste Menschen innerhalb und außerhalb der Kirchen auf, selbstbestimmt Praxen zu vereinbaren, die ihnen – uns – oft als einander ausschließend präsentiert werden: Einerseits gibt es die Notwendigkeit, autonome Räume der Frauenbewegungen zu organisieren und politische Reformen wie Maßnahmen gegen Gewalt und für Frauenförderung zu unterstützen. Andererseits gilt es, in den Bewegungen mitzuarbeiten, die ausbeuterische und patriarchale Strukturen aufdecken und in Reflexionen und Aktionen auf eine grundlegende Veränderung von Gesellschaften hinarbeiten. Dabei müssen auch innerhalb sozialer Bewegungen autoritäre Herrschaftsstrukturen entlarvt und diese Formen, Politik und Theologie zu treiben, in Frage gestellt werden. Dafür müssen wir uns der Anpassung verweigern, Bedingungen von Partizipation, die Herrschaft und Unterdrückung reproduzieren, zurückweisen – und damit auch den Verlust gesellschaftlicher Anerkennung riskieren.
Kriterium für diese Praxis – darin stimmten Nancy Cardoso und Alberto Moreira überein – ist die Orientierung an der Frage: Wem nützt sie? Und damit die tatsächliche Solidarität mit den Ausgestoßenen, die eine Welt zum Ziel hat, in der alle leben können.
edition ITP-Kompass
Michael Ramminger
Seit 2003 gibt es sie nun schon: Unsere Reihe itp-kompass, in der wir in diesem Jahr das zehnte Buch veröffentlicht haben. Die Überlegung zu Beginn war relativ einfach: Der theologische, oder besser befreiungstheologische Büchermarkt war fast völlig zusammengebrochen. Veröffentlicht wurden fast nur noch Beratungsliteratur und Lebenshelfer, viele kleine Verlage wie z.B. edition liberación existierten nicht mehr. So stellte sich für uns die Frage, wie wir unsere Texte zu aktuellen befreiungstheologischen Themen publizieren konnten. Die großen Verlage waren an unseren Themen nicht interessiert oder fordern finanzielle Vorleistungen, die ökonomisch unsinnig sind. Warum also nicht selber publizieren? Das know-how für Lektorat und Layout war vorhanden und mit dem neuen Prinzip „books on demand“ können die Vorabkosten niedrig gehalten werden.
Auf diese Weise haben wir in den letzten Jahren Bücher zu Themen wie sozialen Bewegungen, Globalisierung von unten, feministischer Theologie und Befreiungstheologie auf dem regulären Buchmarkt veröffentlichen können. Darunter befinden sich Monografien wie die des niederländischen Theologen Dick Boer (Erlösung aus der Sklaverei. Versuch einer biblischen Theologie der Befreiung, 2008) oder des bekannten Befreiungstheologen Franz Hinkelammert aus Costa Rica (Das Subjekt und das Gesetz. Die Wiederkehr des verdrängten Subjekts, 2007) ebenso wie Kongressdokumentationen mit Beiträgen namhafter Befreiungstheologen wie Paulo Suess, José Comblin und Francois Houtart oder Sammelbände wie z.B. zur Studentenbewegung von 1968 und den Kirchen (Zwischen Medellín und Paris. 68 und die Theologie, 2009).
Natürlich erreichen wir mit diesen Büchern keine „best-seller“-Auflagen und natürlich verdienen wir an unseren Büchern kaum etwas. Wie vieles in unserer Arbeit ist auch dieser Bereich ein „Zuschuss-Geschäft“. Aber darüber verwundert zu sein, hieße wohl, nicht verstanden zu haben, wie diese Gesellschaft funktioniert. Die kurzen konjunkturellen Hochphasen des befreiungstheologischen Büchermarkts waren eben die Ausnahme: Wer kann schon erwarten, dass ihm der Sand, den er ins Getriebe streuen will, auch noch bezahlt wird. Aber vielleicht ändern sich die Zeiten ja auch einmal wieder. Wir sind jedenfalls stolz darauf, mit unserer Reihe itp-kompass eine „kleine, aber feine“ Nische besetzt zu haben, einen weiteren Raum für unbequeme Wahrheiten und theologisch-politische Überlegungen eröffnet und etabliert zu haben. Und darüber hinaus nutzen wir auch die „neuen“ Kommunikationsmöglichkeiten mit unserer digitalen Bibliothek. Dort werden Bücher und Texte als PDF-Dateien zum Download angeboten, die wir aus unterschiedlichen Gründen nicht als Papierausgaben veröffentlichen können, wie z.B. Texte zur Auseinandersetzung um die Theologie des salvadorenischen Befreiungstheologen Jon Sobrino (Die Armen und ihr Ort in der Theologie), das Buch von Paul Weß: GOTT, Christus und die Armen oder eine sozialgeschichtliche Auslegung des Lukas-Evangeliums von Dietrich Schirmer. Schauen Sie doch mal vorbei: Entweder auf unserer Internetseite unter „Bücher und Materialien“ (http://www.itpol.de/?page_id=20) oder auf der letzten Seite unseres Rundbriefes, auf der wir regelmäßig auf die neuesten Publikationen verweisen.