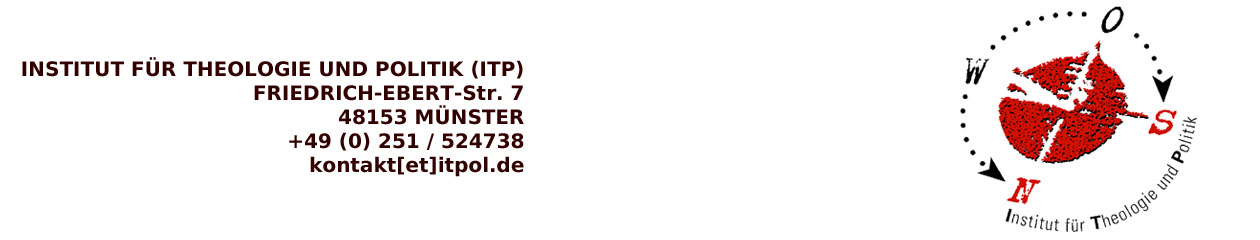erschienen im Juli 2011
Die Beiträge: Ein Konzil vor 50 Jahren – Werbuch Auszug, Migration als Recht auf Bewegungsfreiheit (Boniface Mabanza), Kirchentag mal anders (Selina Moll), Fukushima ist überall – Atomausstieg bleibt Handarbeit (Sandra Lassak), Widerstand im Unterricht? Perspektivische Maßstäbe für den Religionsunterricht (Dieter Michels)
Rundbrief Nr. 35
Liebe Freundinnen und Freunde des ITP,
während hierzulande PolitikerInnen und Medien zufrieden feststellen, dass ‚Deutschland‘ von der Pleite Griechenlands kaum betroffen ist, weil kaum deutsche Produkte dorthin exportiert werden, versuchen die Menschen in Griechenland, die Katastrophe abzuwehren — und werden hier als ‚RandaliererInnen‘ diffamiert, die das Notwendige nicht einsehen: dass die griechische Bevölkerung sparen muss, um die europäischen Banken zu retten. Nur ein Beispiel für die absurden Verhältnisse. Wichtig scheint uns, genau hinzusehen, wem unsere Solidarität gelten soll- te, auch wenn die große Mehrheit der medialen Öffentlichkeit nichts davon wissen will. Ein anderes Beispiel ist gerade wieder besonders aktuell angesichts der mehr als eine Million vor dem Krieg in Libyen Fliehenden: die Flüchtlingspolitik der EU. Boniface Mabanza, der mit dem Netzwerk Afrique-Europe-Interact und dem ITP auf dem Weltsozialforum in Dakar einen Workshop dazu gestaltete, analysiert diese für unseren Rundbrief. Aus Dakar stammen diesmal auch die Bilder.
Im Rahmen unseres Projektes zum 50. Konzilsjubiläum ist ein Werkbuch mit Materialien zum II. Vatikanum, zum Streit um die ‚Kirche der Armen‘, zu zeit- und kirchenpolitischen Kontexten u.v.m. erschienen — wir dokumentieren Auszüge aus der Einleitung. Selina Moll berichtet vom Evangelischen Kirchentag in Dresden und der Arbeitskreis ReligionslehrerInnen stellt Maßstäbe für einen widerständigen Religionsunterricht vor.
Beiträge zum TheologInnen-Memorandum, zu Aktionen gegen die ‚Festung Europa‘, eine Würdigung des kürzlich verstobenen Befreiungstheologen José Comblin und einen Nachruf auf Moe Hierlmeier, Internationalist und politischer Weggefährte, der im Juni unerwartet starb, finden sich auf den Homepages www.itpol.de und www.pro-konzil.de.
Einen widerständigen Sommer und Herbst wünscht
das ITP-Team
Ein Konzil vor 50 Jahren
Auszüge aus der Einleitung zur Werkmappe „Der doppelte Bruch. Das umkämpfte Erbe des II. Vatikanischen Konzils“
Vor 50 Jahren, von 1962 bis 1965, fand im Vatikan in Rom das II. Vatikanische Konzil statt. Konzilien sind in der Tradition der Kirchen Zusammenkünfte, in denen hohe Repräsentanten der Kirche über die Grundlinien, Grundfragen, Grundsätze und das Selbstverständnis beraten und entscheiden. Dass dieses Konzil in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts überhaupt stattgefunden hat, ist die eigentliche Überraschung gewesen. Denn in den Jahren zuvor hatte die oberste Kirchenleitung mehr oder weniger deutlich die Auffassung vertreten, die katholische Kirche sei optimal ausgerichtet, sei so etwas wie eine „perfekte Einrichtung“ […], an der man nichts mehr verbessern könne oder verändern dürfe, weil sie von Gott so gefügt und gut sei.
Dass es dann doch zu einem Konzil kam, ist vor allem dem im Jahr 1958 gewählten Papst Johannes XXIII. zu verdanken. Er kündigte im Jahr 1959 in einer öffentlichen Rede die Einberufung eines Konzils an. Viele Menschen, die an der Erstarrung der Kirche litten, überraschte dies positiv, die Führungsebene der Kirche war eher negativ überrascht und fürchtete unkontrollierbare Neuerungen. […]
Das Konzil war von Anfang an von einem Konflikt zwischen „Bewahrern“ und „Erneuerern“ geprägt, wobei im Laufe der Jahre deutlich wurde, dass die Bewahrer in der Minderheit waren, aber sehr große (kirchen-)politische Macht hatten. Die Konzilsmehrheit entwickelte jedoch eine Eigendynamik. Dies wurde vor allen Dingen darin deutlich, dass die Konzilsversammlung vorbereitete Entschlussvorlagen ablehnte und eigene Positionen entwickelte. Die besonders umstrittenen „Eigengewächse“ […] wurden zum Ende des Konzils beschlossen, so die Aussagen über das Selbstverständnis der „Kirche in der Welt von heute“ vor allem in der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“, und die Formulierungen zur Religionsfreiheit und zum Verhältnis zu anderen Religionen. […]
Kaum zum Tragen kam die Frage des Selbstverständnisses der Kirche als einer Kirche, die sich der Frage von Armut und Ungerechtigkeit in der Welt in besonderer Weise annimmt, indem sie sich nämlich als „Kirche der Armen“ definiert. Diesen Punkt hatten Bischöfe und TheologInnen immer wieder einzubringen versucht. Andere Themen, die damals weniger deutlich, heute aber unübersehbar auf der Tagesordnung stehen, wurden vom Konzil kaum behandelt, wie die Frage der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (in der Kirche), die drohende und voran- schreitende Zerstörung der Erde oder die Entwurzelung der Menschen durch Vertreibung und Flucht.
Das Konzil als Ereignis, das die Welt interessierte und irritierte, ist nur auf dem Hintergrund der Vorgeschichte zu verstehen. Und man muss die Dynamik des Konzils wahrnehmen, will man die Entscheidungen über das Selbstverständnis von Kirche in der Welt von heute begreifen. Dazu gehören schließlich auch die Bemühungen, das Konzil durch einen zweiten Bruch „unwirksam“ zu machen. Das Konzil bedeutete einen Bruch mit vielen bisherigen Selbstverständlichkeiten. Mit diesem ersten Bruch wurde in der Folgezeit wiederum gebrochen, in einem wahren ideologischen Kreuzzug wurden die „Neuerungen“ des Konzils zurückgedrängt. Im Konflikt um die (Be-)Deutung des Konzils hat sich die seinerzeit „unterlegene Konzilsminderheit“ durch ihre starke Position im Vatikan weitgehend durchgesetzt. Ob dies allerdings auf Dauer erfolgreich sein kann, wird sich zeigen. […]
Es wird in den nächsten Jahren einige Versuche geben, an das Konzil vor 50 Jahren zu erinnern. Wir möchten mit dieser Werkmappe Materialien zur Verfügung stellen, mit denen wir versuchen, einige Aspekte dieses Konzils zu verdeutlichen. Und wir meinen, dass uns das Konzil als Ereignis, der damalige Aufbruch aus einer versteinerten Struktur und die Motivationen und Triebkräfte des Aufbruchs einiges sagen können.
Gleichzeitig ist aber auch klar: Unsere heutige Situation ist mit der damaligen, der vorkonziliaren Zeit und der Konzilszeit kaum vergleichbar, auch wenn die Krisenhaftigkeit der kirchlichen Situation heute kaum schlimmer vorstellbar ist, so dass auch wir als diejenigen, die sich noch etwas von der christlichen Nachfolgegemeinschaft erwarten und erhoffen, heute meinen, es bräuchte einen Sprung nach vorn, ein neues Pfingsten. Die Situation der Kirchen heute, vor allen Dingen aber die Situation und Struktur der Gesellschaften, deren Teil diese Kirchen sind, unterscheiden sich sehr von dem, was die Zeit vor dem Konzil prägte.
Die Beschäftigung mit Kirche und Konzil ist als Thema begrenzt, um nicht zu sagen: begrenzt ökumenisch: Warum sich mit der katholischen Kirche beschäftigen, warum sich mit Kirche und Konzil auseinandersetzen? Wir meinen, dass die Erinnerung an die Aufbrüche lohnt. Dabei stehen die Aufbrüche der katholischen Kirche nicht allein. In den 60er und 70er Jahren sind weltweit Aufbrüche zu verzeichnen: Unabhängigkeitskämpfe der „Kolonien“, Kämpfe für die Gleichstellung von Schwarzen in den USA und die Überwindung der Apartheid in Afrika, Gleichberechtigung von Frauen, Studierendenrevolten weltweit und antiimperialistische Befreiungskämpfe. Diese Aufbrüche spiegelten sich auch in den Kirchen, nicht nur in der katholischen; zu erinnern ist hier z._B. an die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1968 in Uppsala/Schweden. Es war eine Zeit, in der Alternativen gedacht und gesucht wurden: Eine andere Welt ist möglich, eine andere Nachfolge Jesu ist möglich. Es ging um Umkehr und um Gerechtigkeit. Dies zeigt sich eben auch, aber nicht nur, im Konzilsereignis. […]
In der Zeit zwischen 2012 und 2015 wird verschiedentlich an die 50 Jahre seit dem II. Vatikanischen Konzil erinnert werden. Wir werden unsere Anliegen in diese Erinnerung einbringen, mit Informationen, Veranstaltungen und Versammlungen. Aktuelle Informationen dazu wird es auf der Internetseite www.pro-konzil.de geben.
Wir wünschen eine gute Lektüre und viele Erkenntnisgewinne für eine heutige christliche Nachfolgepraxis.
Die Redaktion
Migration als Recht auf Bewegungsfreiheit
Boniface Mabanza
Migration stellt eine der größten Herausforderungen der Gegenwart in Afrika dar. In vielen Ländern, wie etwa in Ostkongo, Darfur oder Somalia ist die Flüchtlingsexistenz für Millionen Menschen zum Teil seit mehreren Jahrzehnten zur Normalität geworden. Daran ist zu erkennen, welche Dimensionen diese Problematik angenommen hat. Mit diesen unvorstellbaren Dimensionen verbunden ist die Komplexität der Ursachen und der Folgen von Migration.
Zunächst ist anzumerken: Die Grenzen zwischen erzwungener und freiwilliger Migration sind fließend. Migration wird als Oberbegriff benutzt und als solcher bezeichnet er alle Wanderbewegungen, unabhängig von den Beweggründen, die politischer, wirtschaftlicher oder ökologischer Natur sein können.
Aus europäischer Perspektive ist vielleicht überraschend, dass die binnenafrikanische grenzüberschreitende Migration erheblich größer ist als die von Afrika nach Übersee. Der Anteil der Afrikaner an den Zuwanderern in die europäischen OECD-Länder beträgt kaum mehr als 10 Prozent. Dennoch erweckt die Berichterstattung über die Bootsflüchtlinge aus West- und Nordafrika den Eindruck, dass Menschen afrikanischer Herkunft die Hauptgruppe von MigrantInnen darstellen.
Die Beziehungen zwischen Europa und Afrika sind seit jeher von einer großen Asymmetrie der Machtverhältnisse geprägt. Die formellen Unabhängigkeiten der 60 Jahre, deren 50jähriges Bestehen gerade sehr kontrovers diskutiert wird, haben zu ein paar geringfügigen Verschiebungen beigetragen, eine grundlegende Veränderung im Verhältnis zwischen Afrika und Europa haben sie nicht eingeleitet. Diese Asymmetrie der Machtverhältnisse spiegelt sich auch in den europäischen Migrationskonzepten wider, die sich letztlich immer um zwei grundlegende Strategien drehen: Gefahrenabwehr, wobei es fast immer unklar bleibt, worin denn die Gefahr eigentlich besteht, und Eigeninteressen, auch wenn diese selten offen kommuniziert werden und stattdessen mit altruistischen Floskeln verschleiert werden. Beide Strategien münden in die gleiche Abschottungspolitik..
Das Recht auf Bewegungsfreiheit
Migration als ein Recht auf Bewegungsfreiheit, das jedem Menschen unabhängig von seinem Einkommen, seiner Hautfarbe, seinem Geschlecht und seiner Religion zustehen muss, ist eine innovative, fast revolutionäre Perspektive. Wie fast alle revolutionären Ideen wird diese Perspektive von einer kleinen Minderheit getragen. Sie ist nicht bestimmend im dominanten Diskurs über Migration.
Der dominante Diskurs ist von der selektiven Idee von Bewegungsfreiheit geprägt, die mit einer demonstrativen Selbstverständlich- keit einigen gewährt und anderen verwehrt wird. Die Selektion artikuliert sich entlang der Linien der politischen und wirtschaftlichen Dominanz. Je reicher und mächtiger das Ursprungsland, desto bewegungsfreier. Dieses Selektivitätsprinzip hat sich so etabliert und ist so selbstverständlich geworden, dass es in umgekehrter Form jetzt auch von den Kritikerinnen genutzt wird, indem das Recht zu migrieren auf eine Reparationsleistung reduziert wird. Die Argumente stehen dafür parat, weil die herrschende Wirtschaftsordnung zerstörerisch wirkt: Weil die europäische Fischereiwirtschaft in Westafrika die Fischgründe abfischt und zerstört, wird verständlich, dass bisherige Fischer nun auswanderungswillige Menschen auf die kanarischen Inseln und damit nach Europa transportieren. Die Erschließung und Ausbeutung der Bodenschätze verschmutzt und zerstört die Lebensräume, so dass der Boden für Landwirtschaft unbenutzbar und das Wasser der Flüsse ungenießbar wird. AREVA mit dem Uranabbau in Namibia und Südafrika ist nur ein Beispiel von vielen. Und westliche Firmen nutzen die Tatsache, dass die staatliche Ordnung in Somalia zusammengebrochen ist, um Giftmüll an den Küsten Somalias zu deponieren. Und diese Liste kann man fast unendlich verlängern.
Die Idee, aus dieser Zerstörung Großzügigkeit im Hinblick auf die Bewegungsfreiheit der Opfer der Zerstörung abzuleiten, reduziert die Bewegungsfreiheit auf eine Folge ungünstiger Umstände. Es würde ja im Umkehrschluss bedeuten, Menschen würden sich nicht mehr bewegen, sie wären ein Leben lang an den Ort ihrer Geburt gefesselt, wenn es ihnen gut ginge. Migration ist in sich etwas Positives. Es gab sie früher und es wird sie immer geben.
Migration und Machtverhältnisse
In der dominanten Migrationspolitik spiegeln sich die bestehenden Machtverhältnisse wider. Und diese sind aufgrund der krassen Asymmetrie der Machtverhältnisse von Arroganz der Mächtigen geprägt. Sie ist die Erklärung dafür, dass Bewegungsfreiheit selektiv angewendet wird, dass Armut strukturell erzeugt wird und die Opfer der strukturellen Gewalt ausgegrenzt werden. Dort, wo ihre eigene Bewegungsfreiheit und ihre Interessen nur im Geringsten gefährdet werden, mobilisieren sie alle Kräfte zur Verteidigung. An den somalischen Küsten sind alle Armeen der Industrienationen versammelt. Die Botschaft ist klar: Mit uns ist nicht zu spaßen. Es ist bezeichnend, dass das einzige europäische Opfer an den Küsten Somalias durch eine französische Kugel getroffen wurde, nur weil sich die französische Regierung nicht auf Verhandlungen einlassen wollte.
Um Europas Umgang mit der Migrationsproblematik zu beurteilen, muss man sich vor Augen führen, dass sich der alte Kontinent auf christliche und humanistische Traditionen beruft. Wenn Christentum ernst genommen wird und mehr ist als Prätext für die von Angst geleiteten Auseinandersetzungen mit dem Islam, dann muss man sich fragen, welchen Inhalt diese Grundlagen noch haben. Wie konnten die Präsidenten von Lybien, Khadafi, und Tunesien, Ben Ali, zu zentralen Figuren der europäischen Migrationspolitik werden?
Was ist zu tun?
In Europa geht es um Aufklärung. In der europäischen Öffentlichkeit herrscht viel Unwissenheit über die Selbstverständlichkeit der eigenen Bewegungsfreiheit und über die an Menschen aus anderen Erdteilen angelegten Maßstäbe. Nur die wenigsten wissen, dass zum Schutz Europas vor „Invasionen“ ganze Völker unter Generalverdacht stehen. Außerdem glauben viele europäische Bürger an die von einigen Medien und Politikern vermittelten Eindrücke, dass Europa vor einem großen Ansturm aus Afrika stünde. Es ist eine wichtige Aufgabe der europäischen Zivilgesellschaft, deutlich zu machen, dass solche Ängste unbegründet sind. Und es ist wichtig, an die Freiheit zu erinnern, die der Migration zugrunde liegt.
Es geht auch um politisches Engagement. Migrationspolitik kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss als Teil einer kapitalistischen Rationalität gesehen werden, die alle Lebensbereiche durch- dringt. Nur ein entschlossenes politisches Engagement kann dazu führen, diese Rationalität zu über- denken. In dieser Aufgabe kommt zivilgesellschaftlichen Organisationen eine besondere Bedeutung zu.
In den afrikanischen Ländern sind zwei Faktoren wichtig, um radikale Veränderungen zu bewirken: Es braucht Regierungen, die im Einklang mit den Interessen ihrer Bevölkerungen handeln, und wachsame und engagierte Bürger, die ihre Regierungen dazu bewegen, selbstbewusstes politisches und wirtschaftliches Handeln zu entwickeln, das mit der Weigerung verbunden ist, sich die Arroganz europäischer Politik gefallen zu lassen.
Kirchentag mal anders…
Selina Moll
Ich blicke zurück auf den 33. Evangelischen Kirchentag in Dresden und bin verwundert. Themen wie ziviler Ungehorsam, befreiende Theologien, engagierte Reden für Transformationsprozesse von unten, scharfe Kapitalismus- und Herrschaftskritik kommen mir in den Sinn. Was ist geschehen? Glauben wir den Zusammenfassungen des ZDF, dann ist der Kirchentag tatsächlich politisch gewesen! Und, ja, Aspekte wie der Atomausstieg, Afghanistaneinsatz, Stuttgart 21 kamen zur Sprache und wurden diskutiert. Außerdem gab es wieder mehr Resolutionen als bei den letzten Kirchentagen. Genannt sei die Resolution „Für einen Raum für gleichgeschlechtliche Lebensformen in der Kirche“ und die Resolution „Gegen die Abschiebungen von Roma in die Republik Kosovo“. Vielleicht waren politische Themen beim diesjährigen Kirchentag mehr vertreten als in den letzten Jahren, vielleicht hat er sogar zur Politisierung von einzelnen Jugendlichen oder Gemeindemitgliedern geführt. Beim genauen Hinsehen fällt jedoch auf, dass ein übergeordnetes Thema fehlte und keine klare Positionierung des Kirchentags zu finden war. Hitzige Diskussionen wurden ausgespart und Brennpunktthemen kamen nicht zur Sprache. Es kommen nur die Aspekte zur Sprache, die zur Zeit in aller Munde sind. Was ist aber mit der Grenzschutzagentur FRONTEX, die für eine rassistische Abschottungspolitik der EU steht? Wo wird über den Sozial- und Demokratieabbau in Deutschland gestritten? Was ist mit Kapitalismuskritik? Sind „Arme“ wirklich der Mittelpunkt des Kirchentags? In den 80er Jahren wurde der damalige Verteidigungsminister Hans Apel noch mit Eiern beworfen — dem heutigen Verteidigungsminister Thomas de Maizière, der für eine militärische Beteiligung der Bundeswehr in kriegerischen Auseinandersetzungen steht, wird mit wohlwollendem Verständnis begegnet.
Die zuerst genannten Stichwörter aus meiner Erinnerung stammen allesamt aus Veranstaltungen, die parallel zum Kirchentag verliefen und nicht ins Programm aufgenommen wurden. Eine Mitarbeit von unten ist von den Veranstalter_innen nicht gewünscht; so erlebte es z. B. Publik Forum bei den Programmanfragen. Um dieses Sonderprogramm zu stützen, möchte ich zwei Veranstaltungen herausheben, die ich besucht habe.
Am Rande: Diskussionen über Gewalt und Demokratie
Bei einer Veranstaltung über Christ_innen im Widerstand gegen Rechtsextremismus war der Jenaer Bürgermeister Schröter anwesend. Er beeindruckte durch seine klare Befürwortung und Mobilisierung zu den Anti-Nazi-Blockaden und darüber hinaus durch seine Anerkennung, dass unterschiedliche Aktionsformen notwendig sind, um zur Zeit Anti-Nazi-Blockaden erfolgreich werden zu lassen. Von Blockierer_innen-Perspektive aus wurde deutlich, dass genau hier ein Spannungsfeld beginnt. In- wieweit sollte mensch sich von sogenannten „Chaot_innen“ — die zum Beispiel Mülltonnen anzündeten — abgrenzen, um auch Menschen aus der „Mitte“ der Gesellschaft für weitere Blockaden zu gewinnen, oder inwieweit zersplittert gerade solch eine Abgrenzung die Bewegung, schafft Feindbilder, die für Repression und Medien ein gefundenes Fressen sind, und verkennt eben, dass manche Blockaden erst durch genau solche „Ablenkungsmanöver“ möglich waren. Gewaltlosigkeit darf nicht mit Unschuld verwechselt wer- den. Ein Vertreter der Interventionistischen Linken betonte, dass nicht angezündete Autos, sondern die strukturelle Gewalt unser Problem ist, das Unmut und Wut provozieren sollte.
Eine weitere Veranstaltung handelte von Aufbrüchen und Ausbrüchen im globalen Kapitalismus. Es diskutierten zwei Vertreter_innen des Centro Memorial Martin-Luther-King aus Cuba und Sabine Kebir, freie Publizistin aus Berlin, die zeitweise in Algerien gelebt hat. Inwieweit stellen die Umbrüche in Abya Yala (Lateinamerika) und Nordafrika einen Bruch mit neoliberalen Abhängigkeiten dar? Sabine Kebir sah die Revolten in Nordafrika in der Verschlechterung der Verhältnisse begründet, was sich besonders in zunehmender Arbeitslosigkeit von jungen Menschen und Wohnungsnot zeigte. Die Situation explodierte dann in Folge der Weltwirtschaftskrise mit einer Verteuerung von Grundnahrungsmitteln. Die Lebensmittelkrise betraf nun auch die Mittelklasse, was das Fass zum Überlaufen brachte. Kebir plädierte dafür den Arabischen Frühling zu unterstützen, auch wenn es nicht die transformatorische Umwälzung sei, sondern eher eine reformatorische. Dabei müsse sich Nordafrika von der neoliberalen Ausbeutung und den neokolonialen Abhängigkeiten, vor allem von der EU, trennen. In Bezug auf die Befreiung aus neoliberalem Imperialismus war es den Vertreter_innen aus Cuba wichtig, positive Veränderungen zu benennen: In den letzten 20 Jahren gab es aus ihrer Sicht in Lateinamerika eine Verabschiedung vom Kapitalismus und einen Niedergang des Neoliberalismus sowohl auf politischer Ebene (Venezuela, Bolivien) als auch auf Ebene der sozialen Bewegungen. Dabei sei es zentral, mit der Hegemonie der USA zu brechen und so zum Beispiel die Handelsfreiräume der USA einzuschränken.
Innerhalb dieser neuen Bewegungen muss gefragt werden, was Demokratie bedeutet. In den verschiedenen Kontexten müssen Formen von Alternativen verwirklicht werden. Es ist dabei egal, ob wir es Sozialismus, Anarchismus oder gutes Leben nennen — es kommt auf die Selbstorganisierungs- und Partizipationsprozesse von unten an.
Wider falsche Sicherheiten
Es gab natürlich auch gute Veranstaltungen und Momente auf dem Kirchentag. Da war ein Gottesdienst mit differently-abled people, die beeindruckende Nacht der Lichter auf der Elbe, interessante Gespräche bei den Ständen auf dem Markt der Möglichkeiten, meditative Momente und gute Veranstaltungen in der feministisch-theologischen Basisfakultät. Aber um was geht es an einem Kirchentag? Die Sonderveranstaltungen zum Kirchentag ermutigten zum Widerstand und aktiven zivilen Ungehorsam. Christ_innen müssen aufpassen, nicht in falsche Sicherheiten, vorschnelles Zurückschrecken vor „Illegalität“ und blindes Vertrauen in die Herrschenden zu verfallen, sondern die Umbrüche hin zu einer gerechten Welt G*ttes mutig und wütend selbst in die Hand nehmen. Es gibt keine Versöhnung ohne Gerechtigkeit! Christus und Kirche werden dort sichtbar, wo Menschen mutig aufstehen, „nein“ sagen zu Ungerechtigkeiten, prophetisch ihre Stimme und Hände erheben und einschreiten für eine gerechte Welt G*ttes.
„Fukushima ist überall“
Atomausstieg ist Handarbeit und der Widerstand geht weiter
Sandra Lassak
„Ich frage alle Menschen, die für Atomkraft sind: Haben Sie sich jemals vorgestellt, dass Ihre Familie in der Nähe eines Atomkraftwerkes lebt und im Falle eines Unfalls langsam durch Radioaktivität kontaminiert wird? Haben Sie sich jemals vorgestellt, dass Ihre einzige Heimat, die Erde und das Wasser so verseucht werden, dass man nie mehr mit ruhigem Herzen dort leben kann? Wollen Sie dann immer noch dieses Atomkraftwerk, das ständige Lebensgefahr bedeutet? Dann ziehen Sie bitte mit Ihrer geliebten Familie dorthin und leben Sie dort.“
Mit diesen eindringlichen Worten forderte Naho Dietrich Remoto, die in Fukushima City auf- gewachsen ist und jetzt in Nordrhein Westfalen lebt, auf einer der seit Fukushima jeden Montag stattfindenden Demonstrationen in Münster den sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie und die Abschaltung aller Reaktoren.
Seit dem GAU im japanischen Fukushima demonstrieren wieder Hunderttausende für die Stilllegung der Atomkraftwerke. Die Massenbeteiligung an den Anti-AKW-Protesten, die seit den 1980er Jahren kein so großes Ausmaß mehr erreicht haben, zieht sich quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen und sie zeigt, dass der Atomenergie und damit auch den vier marktbeherrschenden Konzernen RWE, e.on, Vattenfall und EnBW die gesellschaftliche Basis weitgehend entzogen ist. Der Rede von vermeintlich „sicheren“ und „unsicheren“ Atomkraftanlagen wird kein Glaube mehr geschenkt, ebenso wenig wie den Behauptungen der Unmöglichkeit eines sofortigen Atomausstiegs, die mit Horrorszenarien von Energieengpässen und drastischen Strompreiserhöhungen untermauert werden. Das Ausmaß der Katastrophe im Hochtechnologieland Japan, die von einer kontrollierbaren Situation weit entfernt war und ist, auch wenn Regierung und Atomlobbyisten alles dafür taten, dies so darzustellen und den GAU zu vertuschen, hat nur allzu deutlich gezeigt: „Fukushima ist überall“. Die allgegenwärtige Bedrohung und die katastrophalen Auswirkungen der Atomindustrie auf Mensch und Natur, angefangen von den massiven Umweltzerstörungen und höchstgradigen Gefährdungen durch den Uranabbau bis hin zu Atommüllendlagern, wurde durch Fukushima wieder ins öffentliche Bewusstsein gebracht. In zahlreichen Städten finden seit der Reaktorkatastrophe jeden Montag Demonstrationen und Mahnwachen statt und bei den diesjährigen Ostermärschen gingen bundesweit Zehntausende gegen Kriegseinsätze und für den sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie auf die Straße. An verschiedenen Atomstandorten fanden Protestaktionen und Kundgebungen statt. Allerdings hat nicht erst seit dem 11. März 2011 (Fukushima) für die Anti-AKW-Bewegung ein „neuer Frühling“ begonnen. Bereits im Herbst letzten Jahres hatte die Aufkündigung des sogenannten Atomkonsenses durch die schwarz-gelbe Regierung der Anti-AKW-Bewegung neuen Auftrieb gegeben. Man hatte aus Tschernobyl nichts gelernt, ein grundsätzlicher Kurswechsel in der Atompolitik war nicht gewollt. Bereits kurz nach dem Regierungsantritt 2009 zeigte sich, wie leicht sich die Regierung aus CDU und FDP von den Interessen der Atommafia korrumpieren lässt. Umweltleitlinien wurden abgeschafft und Hermesbürgschaften für den Bau von Atomreaktoren genehmigt, wie z._B. für den Bau des AKW Angra 3 in Brasilien durch den Siemens-Konzern. Dabei war und ist es auch gleichgültig, dass Angra 3 in einer Erdbebenregion liegt, dass Brasilien den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben hat und Teile der brasilianischen Regierung bereits von der Atombombe träumen.
Schon der vergangene Herbst zeigte, dass der Atomausstieg nur durch Druck von unten und Widerstand erreicht werden kann. Mehr als 10.000 Menschen bekundeten im November letzten Jahres ihre Abschaltungsforderung mit Gleis- und Straßenblockaden und kollektiven Schotteraktionen, um die Fahrt der Castortransporte ins Atommülllager Gorleben zu stören. Auch vom ITP beteiligten wir uns an den viertägigen Castorprotesten im Wendland. Die hinsichtlich der großen Mobilisierung sowie der sehr guten Koordinierung erfolgreichen Proteste in Gorleben haben gezeigt: Wir sind viele, die dem Wahnsinn ein Ende setzen wollen.
Ein halbherziger Kompromiss
Die gegenwärtige Hinhaltetaktik und der nach Ablauf des Moratoriums beschlossene halbherzige Atomausstieg bis 2022 machen klar, dass sich Regierung und Atomlobbyisten von den nuklearen Katastrophen, Strahlentoten, von nach- haltiger Umweltzerstörung nicht sonderlich beeindrucken lassen, sondern stattdessen mit politischen Kompromisslösungen auf „Befriedungsstrategien“ setzen. Gegen diesen wiederaufbereiteten Atomkonsens muss die Forderung jedoch heißen: Atomausstieg jetzt und sofort! Es braucht weiter den Protest der Straße, es geht darum, sich dem Weiterbetrieb von Atomkraftwerken durch Massenblockaden in den Weg zu stellen.
Mut zum Widerstehen und zivilem Ungehorsam
Blockaden sind Formen zivilen Ungehorsams, um gegen todbringende Technologie zu protestieren, um darauf aufmerksam zu machen, dass Menschenrechte und Bewahrung des Lebens der Konzernherrschaft und Profitgier geopfert werden. Diese Formen zivilen Ungehorsams sind deshalb nicht nur notwendig, sondern auch — entgegen Kriminalisierung und Polizeirepression — legitime Widerstandspraxen, um Lebensrechte von Menschen und natürliche Lebensgrundlagen zu verteidigen.
Im Widerstand gegen Atomtechnologie geht es um ein „Mehr“ als um das Abschalten: Es geht um einen tiefgreifenden Wandel der allein an Profitinteressen orientierten Wirtschaftsordnung. Es geht um politische Interventionen, die zum einen darauf zielen, die Macht der Konzerne zu brechen und Energieversorgung zu vergesellschaften, zum anderen, ausgehend von den gegenwärtig umkämpften ökonomischen Strukturen neue Produktions- und Konsumweisen, konkrete alternative Lebenspraxen zu entwerfen und zu erstreiten.
Und: Atompolitik ist kein rein bundesrepublikanisches oder europäisches Problem. Technologieexport, Lebensraum und Leben zer- störender Uranabbau in den Ländern des Südens, Aufbau von Atomindustrie in den „aufstrebenden“ Wirtschaftsnationen des Südens wie z._B. in Brasilien, Chile, Indien und schließlich der direkte Zusammenhang von sogenannter „friedlicher Nutzung“ und Atomwaffenproduktion zeigen die globalen Zusammenhänge.
Als ChristInnen können und dürfen wir die gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen nicht scheuen oder die Augen davor verschließen. Deshalb werden wir mit „Hand anlegen“ im weiteren Kampf für den Atomausstieg. Sollen doch diejenigen, die weiterhin Atomenergie wollen, dahin gehen, wo „die Erde und das Wasser so verseucht werden, dass man nie mehr mit ruhigem Herzen dort leben kann“.
Perspektivische Maßstäbe für einen „widerständigen Religionsunterricht“
Dieter Michels
Im ITP-Arbeitskreis haben wir uns immer wieder davon beunruhigen lassen, dass auch ReligionslehrerIn- nen möglicherweise nicht davor gefeit sind, sich mehr oder weniger freiwillig zu Lobbyisten gesellschaftlich dominanter Anpassungsinteressen, zu informellen Mitarbeitern schulischer Kapitalsicherung im Bildungssystem, zu Garanten für die Einübung in Markt„rationalität“ machen zu lassen — bei der Zurichtung von Jugendlichen für eine „knochenharte“ (1) Arbeits- und Gewinnmaximierungswelt mitzuwirken, statt SchülerInnen hilfreich, biblisch inspirierend und orientierend einzuladen und zu befähigen, sich zu den „Leuten des (alternativ-widerständigen) Weges“ (Apg 9,2) zu gesellen.
Wir wollen keine marktgläubigen „Kopflanger“ und auch nicht — kaum weniger harmlos — gutwillige, aber kooptierte Moderatoren zwischen Konkurrenz-Kompetenz und sozialem Lernen werden. Deshalb haben wir unsere Analysen, Überlegungen und Phantasien auf ein widerständiges, alternativ-biblisches, dem Lauf der globalen Prozesse gegenläufiges messianisches Curriculum (2) bzw. dazugehörige paradigmatische Themen, geeignete Arbeitsweisen und Projekte hin ausgerichtet. Ein wichtiger Zwischenschritt der Vergewisserung können u. U. die in den untenstehenden „Maßstäben“ aufgestellten Wegmarken sein. Sie weisen andere Wege aus als die aktuellen „kompetenz“-orientierten Lehrpläne, die in letzter Instanz ja immer dem herrschenden Kapitalverwertungsinteresse entsprechende kompetitive Kompetenzen einfordern. Sie sind da- gegen an inhaltlich-messianischer Konkretisierung von „Kompetenzen“ in bestimmten Inhalten einer anderen, möglichen Welt orientiert. Sie gehen davon aus, dass jüdisch-christliche messianische Kompetenzen im Religionsunterricht (RU) „lernbar“ und „lehrbar“, bildungsmöglich und bildungswirksam sein könnten.
Im Eintreten für genuin jüdisch-christliche Optionen müsste RU in der Schule zu einem besonderen Ort werden, einem:
I. Ort der Einübung von Compassion (3)
II. Ort der Erinnerung an die großen Befreiungs- und Solidaritäts-Traditionen des Ersten und Zweiten Testaments
III. Ort der gefährlichen und rettenden Erinnerung an die von christlichen und bürgerlichen Imperien sowie herrschenden ökonomischen Mächten heraufbeschworenen Katastrophen, insbesondere an die Leiden der Opfer (ihre Unterdrückung, Entwürdigung, Marginalisierung, Ausschließung, Auslöschung)
IV. Ort des Offen- und Wachhaltens eines universal-messianischen Hoffnungs-Horizontes auch für die aus der Geschichte Verschwundenen
V. Ort des Kennenlernens und Kontaktes mit der jesuanischen Befreiungsbewegung im Kontext der Pax Romana und der gegenwärtigen Globalisierung von oben (d. h. mit Jesus-messianisch orientierten Bewegungen, Gemeinschaften, Institutionen, Initiativen, Kampagnen)
VI. Ort der Konfrontation mit der neoliberalen Funktion von Schule als Startrampe und Ausbildungsagentur für markt- und kapitalkonforme Wettbewerbsfähigkeit
VII. Ort des Verlernens von Geld- (Kapital-) und Marktgläubigkeit und der kritisch-analytischen Konfrontation mit den korrespondierenden Götzentheologien
VIII. Ort der Orientierung an und Inspiration durch exemplarische Lebenswege konsequent und radikal im Dienst messianischer Hoffnungen auf eine andere (befreite und solidarische) Welt stehender Frauen, Männer und Jugendlicher
IX. Ort des Gegenlernens — der Einübung in die Organisation von Möglichkeiten einer anderen Welt, der Widerständigkeit und des praktizierten Widerstandes gegen ökonomistische und konsumistische Verführungen, gegen (bis in die Schule getragene) Zumutungen marktradikaler Mächte
X. Ort einer universal und interkulturell geöffneten Wahrnehmung und Gewissens- Bildung von den Rändern her — und von denen her, die dort um ein Leben in Würde kämpfen
XI. Ort der mit allen anderen Perspektiven immer gleichzeitigen Stärkung von Zusammenhalt, Gegenseitigkeit und Gemeinsinn unter den SchülerInnen.
Wie diese Maßstäbe im praktischen Schulalltag wirksam werden können, entscheidet sich an den Antworten auf schwierige und vielleicht auch gefährliche didaktische und (schul-)politische Fragen. Sie müssten im Sinne und im Interesse der benannten perspektivischen Maßstäbe gestellt und beantwortet werden.
Anmerkungen
(1) Vgl. Mt 25,24, wo einem prototypischen Sachwalter solcher Interessen die entsprechende interessenskonforme „notwendige“ „Härte“ mutig und unter hohem persönlichem Risiko (vgl. Mt 25, 30) vorgehalten wird. Schon Pharao wird diese „Herzensversteinerung“ als „spirituelle“ Spiegelung der scheinbaren Alternativlosigkeit des ägyptischen Systems in der Befreiungserzählung der Tora mehrmals zugeschrieben.
(2) „Curri“-culum nicht als Trainingsmanual für Wett„läuferInnen“, sondern als Inspiration und Richtschnur für „Halakha“, „Gehen“- Lernen in den Fußstapfen eines aus „Ägypten“ befreit-befreienden Volkes und aller, die sich entschlossen haben, mit ihm „Wege der Gerechtigkeit“ (Mt 21,32) in eine „ganz anders“ als (im ersten Jahrhundert, so „gut“ wie heute) „normal“ globalisierte Welt hinein zu suchen.
(3) Im Leitwort „Compassion“ (J.B. Metz) fließen Grundintentionen der kath. und ev. Neuen Politischen Theologie (J. Moltmann; J. B. Metz; D. Sölle) zusammen; ausgehend von der biblischen „chessed“ JHWHs, die sich in „Solidarität“ in Israel und unter den Völkern bewährt: von der Leidensempfindlichkeit JHWHs und der entsprechenden Wahrnehmungspflicht der Töchter und Söhne JHWHs, die am Anfang von allem steht (Ex 2, 23-25; 3, 7-10) bzw. für uns heute verheißungsvoll stehen müsste; das also, woraus Solidarität entspringt, was sie stark macht, ihrem analytischen Blick die Richtung weist und ihn prophetisch über die herrschende Weltordnung hinaus zu treiben vermag.