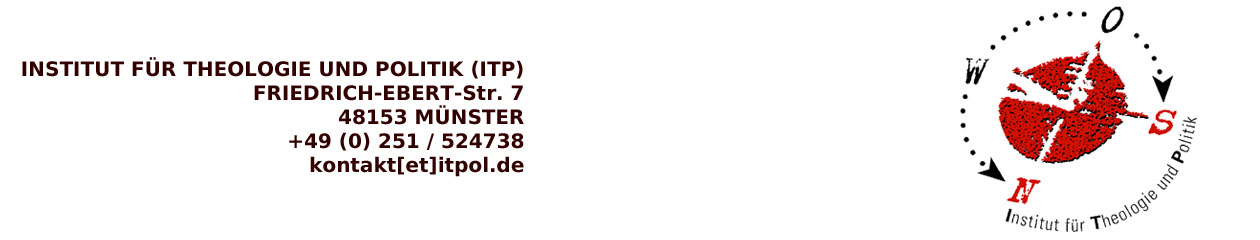Dies ist der vierzigste Rundbrief unseres Instituts für Theologie und Politik. Die Rundbriefe dokumentieren nun seit zwanzig Jahren unsere Arbeit im ITP. Das ist viel für eine von staatlichen und kirchlichen Finanzen unabhängige Einrichtung, die sich der politisch-theologischen Bildungsarbeit verschrieben hat. Und deshalb möchten wir uns bei allen bedanken, die durch ihren Beistand, ihre Arbeitskraft und nicht zuletzt durch ihre Spenden Teil dieser erfolgreichen zwanzig Jahre gewesen sind!
Ein neuer Schritt
Michael Ramminger
Neuaufstellung und Verstetigung
Aber jetzt, nach zwanzig Jahren, steht auch eine Neuaufstellung an, die für uns eine große Herausforderung ist: Es geht dabei nicht um unsere inhaltliche, theologische Ausrichtung, nicht um unser Bemühen, die Welt global zu denken, befreiungstheologische Themen wei- terzuentwickeln und öffentliche Diskussionen anzustoßen, in sozialen Bewegungen und unter christlichen Engagierten präsent zu sein, Menschen zu motivieren und zu organisieren. Es geht vielmehr darum, dem ITP eine neue Struktur zu geben.
Wir haben es bereits im letzten Rundbrief erwähnt: Einige haben das ITP verlassen, andere sind neu, wenn auch nicht ganz neu, hinzugekommen. Das begreifen wir als eine große Chance, das ITP über ein „Generationenprojekt“ hinaus zu verstetigen. Wir haben in diesem Jahr mit vielen von Euch und von Ihnen darüber gesprochen, wie ein neues ITP aussehen könnte.
Zwei Dinge haben wir dabei entschieden: Wir haben den Förderverein stärker in die Begleitung und Unterstützung des ITP eingebunden. Und: Wir wollen und müssen im ITP bezahlte Stellen schaffen, wenn diejenigen, die schon angefangen haben, Verantwortung für die nächsten zwanzig Jahre im ITP zu übernehmen, bei uns bleiben können sollen.
Das ist vielleicht die größte Herausforderung: Wir werden drei Stellen finanzieren müssen. Mit Julia Lis haben wir bereits eine Geschäftsführerin gewonnen. Aber ihre Stelle ist nur für ein Jahr gesichert. Zwei weitere Stellenfinanzierungen brauchen wir mindestens noch für unsere „Theologie von Unten“. Am 8. Februar 2014 findet eine große Vereinsvollversammlung statt, auf der wir über diese Dinge entscheiden werden. Wir möchten Euch und Sie herzlich einladen, an diesem Treffen teilzunehmen, mit uns gemeinsam neue Ideen zu entwickeln oder vielleicht einfach nur (förderndes) Mitglied im Verein zu werden.
Rückblick: 20 Jahre ITP
Als wir Anfang der neunziger Jahre, kurz nach dem „Epochenbruch“ von 1989, das ITP gegründet haben, war uns klar, dass die Zeiten für ein Projekt globaler Solidarität, in dem Christ_innen eine Rolle spielen, nicht einfach werden würden.
Wir haben in diesen Jahren immer wieder wichtige Themen aufgegriffen: 1994 eine Tagung „Armut in Nord und Süd“, 1995 „Arbeit für Alle in Nord und Süd“ mit den Befreiungstheolog_innen Fernando Castillo, Rogerio Almeihda Cunha und Elisabeth Vargas-Koch. Später (und immer mal wieder) Tagungen mit Franz Hin- kelammert zu Fragen von Globalisierung, Menschenrechten und Re- ligionskritik, 1996 ein Seminar zur „Option für die Anderen“ mit Paulo Suess (Brasilien), Kuno Füssel und Fernando Castillo (Chile). 1997 diskutierten wir feministische Perspektiven „Die Hälfte der Welt — Frauen und Entwicklung” mit Gabriele Zdunnek, Encarnacion Rodriguez, einer Freundin aus dem Iran und Angelica Batres (El Salvador). Im gleichen Jahr fand auch ein Workshop mit der KAB Bayern zu Fragen von Flucht und Rassismus statt.
Ab 1995 konnten wir ein Forschungsprojekt zu „Krise und Perspektiven von Dritte-Welt-Gruppen“ durchführen. 1998 setzten wir einen wichtigen Punkt in der Anti-Globalisierungsbewegung mit dem Kongress „25 Jahre Modell Chile — 25 Jahre Neoliberalismus“ mit ca. 400 Teilnehmer_innen und grandiosen internationalen Referent_innen, u. a. Franz Hinkelammert, Pablo Richard und Marcel Claude, der in diesem Jahr Präsidentschaftskandidat der chilenischen Grünen war. 2002 arbeiteten wir an dem Projekt „Von Süd nach Nord — ExpertInnenaustasch umgekehrt“. Hier haben Freund_innen aus Lateinamerika unsere „Entwicklungsversuche“ im Norden mit Blick auf das Thema „Nachhaltigkeit“ hin evaluiert. 2003 standen mit dem Christologiekongress theologische Fragen im Vordergrund, ein Jahr später fand die internationale Tagung „Globalisierung und Frauen. Feministisch-Theologische Herausforderungen“ statt — u. a. mit Nancy Cardoso, Marcella Althaus-Reid und Veronika Schild. 2005 organisierten wir mit der päpstlichen Universität Sao Paulo und Goiais (Brasilien) einen großen Kongress anlässlich „Vierzig Jahre II. Vatikanum“, an dem u.a. Kardinal Arns, eine der großen kirchlichen Figuren der Befreiungstheologie, teilnahm.
Aktuelle Arbeitsfelder
Es gäbe noch viel zu erwähnen: Das Forum Gemeinde und Politik, der missionswissenschaftliche Kongress „Crossroads“ … Das ITP hat an Katholiken- und Kirchentagen, an den Weltsozialforen, dem Weltforum für Theologie und Befreiung teilgenommen, wir haben politische Netzwerke mitgegründet, arbeiten in lokalen Bündnissen und sind aktiv in den Krisenprotesten gegen die Politik der Troika.
Wir haben diverse Werkhefte, Arbeitshilfen und Dokumentationen erstellt, inzwischen in unserer Reihe „itp-kompass“ dreizehn Bücher herausgegeben und ungezählte Artikel geschrieben. In den letzten Jahren haben wir wieder befreiungstheologische Sommerschulen durchgeführt, am neu entstandenen Befreiungstheologischen Netzwerk mitgearbeitet. Und nicht zuletzt haben wir im letzten Jahr, gemeinsam mit der „Leserinitiative Publik“, Wir sind Kirche und an- deren die Konziliare Versammlung mit 500 Teilnehmer_innen in Frank- furt organisiert und durchgeführt, deren Impulse in den nächsten Jahren im Projekt „Konziliarer Ratschlag“ fortgeführt werden sollen.
Ideen und Arbeit gibt es also mehr als genug. Wir hoffen, dass wir das gemeinsam mit Eurer und Ihrer Hilfe schaffen werden. In diesem Sinne wünschen wir allen eine gesegnete Weihnachtszeit in Erinnerung und Erneuerung an die nicht verlöschende Hoffnung für die, die den Frieden, Gerechtigkeit und ein neues Zuhause brauchen.✶
Konziliare Versammlung – und jetzt?
Katja Strobel
Vor einem Jahr fand die Konziliare Versammlung in Frankfurt am Main statt. „Hoffnung und Widerstand“ hieß das Motto, unter dem sich rund 500 Aktive aus Kirchenreformgruppen, sozial und politisch engagierte Christ_innen, trafen und über die Erinnerung und Aktualisierung des II. Vatikanischen Konzils sowie über die Zeichen der Zeit austauschten. Dies geschah in Workshops, Vor- trägen und Diskussio- nen, aber auch auf der Straße, beispielsweise durch die Aktion „ChristInnen gegen den Finanzkapitalismus“ vor der Deutschen Bank und in Erinnerung an den Todesmarsch der KZ-Gefangenen der Adlerwerke im Stadtteil Gallus. Die Atmosphäre war von Solidarität und dem Gefühl von Aufbruch geprägt; der Ahnung, eine neue Art und Weise der Zusammenarbeit versprengt arbeitender Gruppen könnte ihren Anfang nehmen. Dies schlug sich auch in der intensiven Diskussion um die Botschaft der Versammlung nieder, die letztendlich unter anderem formulierte: „(…) Wir sind Volk Gottes, wenn wir mit vielen suchenden Menschen weltweit, mit feministischen sozialen und politischen Menschenrechts- und Demokratiebewegun- gen verbunden sind. (…)“ Ein Anspruch, den es einzulösen gilt!
Kleine Schritte und Spuren
Ein Jahr später ist zunächst einmal festzustellen: Alle haben sich wieder in ihren Alltag eingefunden. Eine kleine Gruppe fand sich zusammen, um einen Konziliaren Ratschlag im Mai zu organisieren, eine andere kleine Gruppe bereitet einen weiteren Ratschlag für den Herbst 2014 vor und im November 2015 wird voraussichtlich bei den Domitilla-Katakomben in Rom eine Veranstaltung anlässlich „50 Jahre Katakombenpakt“ (siehe Rundbrief Nr. 32) stattfinden. Darüber hinaus wird es Treffpunkte, wie die Ökumenische Versammlung 2014 oder den Katholikentag in Regensburg geben, an denen sich einige an der Versammlung Beteiligte weiter austauschen können.
Um den Anspruch aus der Botschaft umzusetzen, muss sich die lokale und regionale Arbeit an dieser orientieren. Inwiefern dies statt- findet, lässt sich kaum beurteilen, aber zumindest von den Diskussionen in der Arbeitsgemeinschaft Feminismus und Kirchen kann ich berichten, dass die Versammlung Früchte getragen hat, die vielleicht manchmal nicht so offensichtlich sind, aber die im Sinne der Reich-Gottes-Kirche wirken. Die Idee der Verknüpfung von Kirchenreform und Gesellschaftskritik ist angekommen. Zwar herrscht vielerorts Ratlosigkeit angesichts der anachronistischen Strukturen von Kirche — da steht der neue Papst mit seinen Hoffnung weckenden Kurienreformen und seinem symbolisch bedeutsamen Besuch auf Lampedusa zum Beispiel gegen eine Herrenkirche im Bistum Limburg, die einer den Atem verschlägt. Aber dass „Kirchenreform“ auch heißen kann, andere, basisdemokratische und an den sozialen Fragen orientierte Gemeinden aufzubauen und unabhängige Orte zu nutzen, diese Überzeugung findet langsam aber sicher mehr Anhänger_innen.
Kirche mitten im Leben
Der Ratschlag im Mai beschäftigte sich mit den Themen „Hunger und Eucharistie“, der Aktualisierung des Katakombenpakts, Protesten gegen die europäische Krisenpolitik und der Kampagne „Aufschrei gegen Waffenhandel“. Einige Ergebnisse sind auf der Website www.pro-konzil.de nachzulesen. Ein ganz konkretes Ergebnis war die gemein- same Beteiligung von einigen aus dem Befreiungstheologischen Netz- werk und der Kirchenvolksbewegung „Wir sind Kirche“ an den Blockupy-Protesten in Frankfurt.
Im Herbst 2014 möchten wir uns mit dem Thema „Sprache, Religion und Herrschaft“ beschäftigen. Unter anderem werden wir dort das auf der Konziliaren Versammlung immer wieder aufgekommene Thema der Sprachfähigkeit und der Vermittlung befreiungstheologischer Ideen gegenüber Menschen aufgreifen, die nicht im für die BRD typischen christlich-bürgerlichen Milieu aufgewachsen oder mit ihm vertraut sind. Nicht, um zu missionieren, sondern um den Anspruch der Botschaft einzulösen, uns mit feministischen sozialen und politischen Bewegungen zu verbinden, zu denen christliche Gruppen hierzulande bisher nur wenig Beziehungen haben. Vielleicht kann das bedeuten, ein wenig im Sinn von Dietrich Bonhoeffers religionslosem Christentum, von Gott so zu sprechen, dass die Relevanz für das (Über-)Leben deutlich wird: „Die Religiösen sprechen von Gott, wenn menschliche Erkenntnis (manchmal schon aus Denkfaulheit) zu Ende ist oder wenn menschliche Kräfte versagen (…). (…) und ich möchte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, nicht in den Schwächen, sondern in der Kraft, nicht also bei Tod und Schuld, sondern im Leben und im Guten des Menschen sprechen. (…) Gott ist mitten in unserem Leben jenseitig.“ (1)
Anmerkungen:
(1) Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hg. von Eberhard Bethge, 10. Aufl., München 1978, 134f.✶
Bruch und Option
Zwei Basiskategorien einer Theologie der Befreiung
Philipp Geitzhaus
Die folgenden Überlegungen sind im Rahmen der Befreiungstheologischen Sommerschule „Komm mit auf die Straße!“, die 2014 vom ITP und dem Befreiungstheologischen Netzwerk or- ganisiert wurde, entstanden. Die jährlichen Sommerschulen bieten die Möglichkeit, auch die scheinbar evidenten Fragen und Themen kritisch zu hinterfragen und neu zu denken.
Die Befreiungstheologie ist vorbei: Ausgestanden, überwunden, vielfach sogar schon vergessen. Natürlich ist das eine stark vereinfachte Aussage. Heute gibt es ja immer noch und immer wieder Theologien, die sich — wenigstens im weitesten Sinne — als politische Theologien verstehen. Dabei handelt es sich zum einen um Ausdifferenzierungen der „klassischen Befreiungstheologie“, aber auch um solche, die ganz andere theoretische Entwicklungen und soziopolitische Entstehungsorte aufweisen. Zu nennen wären hier vor allem die postkolonialen, feministischen und queeren Theologien; die Liste ließe sich fast beliebig erweitern.
Pluralität der Theologien und das gemeinsame Projekt „Befreiung“
Während der letzten Befreiungstheologischen Sommerschule in Münster waren verschiedene po- litisch-theologische Hintergründe präsent. Die Frage, mit der wir uns deshalb immer wieder, mindestens implizit, konfrontiert sahen, war: Was ist das Gemeinsame der verschiedenen politischen Theologien? Gibt es überhaupt etwas Gemeinsames? Wie können wir heute von befreiender, politischer Theologie, vielleicht von Befreiungstheologie sprechen?
Es gibt sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten, Befreiungstheologie vorzustellen. Naheliegend ist eine historische Betrachtungsweise: In den 1960er/70er Jahren gab es in Lateinamerika viele nationale Befreiungskämpfe, in denen auch zahlreiche Christ_innen mitkämpften. Es entwickelten sich in dieser Zeit aktive Basisgemeinden, die auf Grund ihres christlichen Glaubens politische, solidarische Arbeit leisteten. Das gemeinsame politische Projekt hieß „Befreiung“, Befreiung der verarmten Bevölkerung. In diesen Kontexten entstand auch die kritisch-theologische Reflexion dieser politischen Befreiungspraxis, die Theologie der Befreiung. Spätestens mit dem Ende der Militärdiktaturen in Lateinamerika löste sich das Verständnis von Armut und Befreiung von der ökonomischen Engführung ab und es entwickelten sich diverse befreiende Theologien, bis heute.
Bruch und Option
Eine andere (keine dem widersprechende!), eher systematische Möglichkeit, Befreiungstheologie zu charakterisieren, die wir auf der Sommerschule diskutiert hatten, war, diese Theologie mit den grund- legenden Kategorien Bruch und Option zu verstehen. Beide Kategorien sind aufeinander bezogen und funktionieren nur in ihrer Reziprozität. Für sich genommen sagen diese Kategorien natürlich noch wenig, deshalb gilt es, sie näher zu bestimmen.
Der Bruch meint einen epistemologischen und politischen Bruch mit der herrschenden Theologie und vor allem mit den gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen. Die Herrschaftsstrukturen werden im Lichte des Evangeliums als unterdrückerisch verstanden, insofern sie Leben (in Würde) verweigern, statt es zu fördern. Der entscheidende und unterscheidende Punkt, der die Befreiungstheologie ausmacht, liegt nun darin, wie sich die Theologin zu dieser (Glaubens-)Erkenntnis verhält. Es geht nicht mehr nur darum, Leid zu interpretieren, zu theologisieren, sondern es zu überwinden (1). Insofern gibt die Theologie der Praxis, der befreienden Praxis, den Vorrang. Der französische Theologe Georges Casalis hebt hervor: „Es sei jedoch ausdrücklich betont, dass es sich um eine völlig andere Theologie handelt, die die Praxis der Befreiungskämpfe als primär und ihre Deutung im Lichte des Evangeliums als zweiten Akt begreift.“ (2) Das impliziert auch einen parteilichen Umgang mit der Praxis. Es geht darum, sich in den Befreiungsbewegungen und in der „Welt der Armen“ (Ignacio Ellacuría) zu verorten. Und in einer Welt, die so viel Armut und Ausgrenzung produziert, Partei für die Armen und Ausgegrenzten zu ergreifen und damit auch aus ihrer Perspektive diese Strukturen zu überwinden hin auf eine Welt, in der alle ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend leben können. Das meint der Terminus „Option für die Armen“. Die feministische Befreiungstheologie konkretisierte diese Option noch einmal, indem darauf hingewiesen wurde, dass die Verarmung und Ausgrenzung vor allem geschlechtlich geprägt ist. Später wurde diese Option zu einer „Option für die Anderen“ (3) erweitert, die die verschiedenen Facetten von Ausgrenzung und Ausbeutung (ökonomisch, rassistisch, sexistisch…) ausdrücken möchte. „Die Option für die Anderen [wird] als eine Radikalisierung und Vertiefung der Option für die Armen, wie sie in kirchlichen Verlautbarungen, aber auch in der Sicht der Befreiungstheologie formuliert war, verstanden.“ (4)
Befreiungstheologie als Gegentheologie
Die beiden Kategorien Bruch und Option wollen ermöglichen, dass eine bzw. die Theologie der Befreiung zwar an das Ziel der Befreiung, nicht aber notwendig an nationale Befreiungsbewegungen, wie es sie in den 1960er und 70er Jahren (vorher und später natürlich auch) gab, gebunden ist. Damit steht und fällt sie auch nicht mit diesen Bewegungen, sondern sie muss wachsam sein für die je neuen emanzipatorischen Aufbrüche und sich in diesen auch verorten können — auch in den „Zeiten messianischer Dürre“ (Elsa Tamez). Wie man sich also bezüglich der Befreiungstheologie positioniert, hängt auch mit der Positionierung und Interpretation heutiger emanzipatorischer Kämpfe zusammen. Wie stelle ich verschiedene Kämpfe zueinander ins Verhältnis und ordne sie historisch ein? Auf welche Tradition(en) beziehe ich mich in meiner Reflexion und Theoriebildung?
Heute von Befreiungstheologie zu sprechen, hieße m. E. die gegenwärtigen (globalen und lokalen) emanzipatorischen Bewegungen zu suchen und aus ihnen heraus das Ziel der Befreiung zu erarbeiten. Das impliziert, Partei zu ergreifen (Option), aber diese Parteilichkeit auch auf ihre Universalisierungsfähigkeit hin zu überprüfen und diese im Sinne der Befreiung zu vermitteln, denn Gerechtigkeit kann es immer nur für alle geben (Boniface Mabanza). Diese Option schließt den Bruch mit einer „Zuschauertheologie“ ein. „Es erweist sich als wesentlich für die ‚Gegentheologie‘ und wird immer mehr zu ihrem Bewährungskriterium, dass sie keine Zuschauerhaltung duldet.“ (5) Das gilt heute wie damals.
Anmerkungen:
(1) Vgl. Jon Sobrino, Theologisches Erkennen in der europäischen und der lateinamerikanischen Theologie, in: Karl Rahner (Hg.), Befreiende Theologie. Der Beitrag Lateinamerikas für die Gegenwart, Stuttgart 1977, S. 132.
(2) Georges Casalis, Die richtigen Ideen fallen nicht vom Himmel. Grundlagen einer induktiven Theologie, Stuttgart 1980, S. 89.
(3) Michael Ramminger, Mitleid und Heimatlosigkeit. Zwei Basiskategorien einer Anerkennungshermeneutik, Luzern 1998, S. 28-30.
(4) Ebd. S. 30.
(5) Casalis, S. 89.✶
„Glaube nicht, dass Allah die Handlungen der Unterdrücker ignoriert.“ (Koran 14:42)
Benedikt Kern
„Ich fühle mich sowohl in der schiitisch-jafaritischen Tradition verwurzelt als auch in der spirituellen Richtung des Sufismus. Politisch definiere ich mich als linksextreme Muslima, Antikapitalistin, Antiimperialistin und Ökofeministin!“ So stellte sich Mathilde Soukeyna zu Beginn ihres Workshops auf der Befreiungstheologischen Sommerschule vor, den sie zusammen mit Maya und Ludovic Mohammed Zahed durchgeführt hat. Alle drei kommen aus Paris und engagieren sich seit 2006 in der Bewegung „Baraka“, der es um die Verbindung von sozialer Gerechtigkeit, Ökologie und Feminismus geht. Ludovic Mohammed ist Aktivist in der Vereinigung progressiver Muslime und setzt sich dort besonders für die Anerkennung Homosexueller innerhalb des Islams ein.
Politische Theologie im Islam
Die Herangehensweise von Baraka, politische Theologie zu treiben, stellt eine fundamentale Kritik an der allgemein verbreiteten Theologie der Unterdrückung innerhalb des Islams dar und ist auf der Suche nach Schlüsselbegriffen in der Re-Lektüre der Korantexte, um darin die Grundlagen eines aktiven, transformierenden und befreienden Glaubens zu verorten.
In dem Workshop auf der Sommerschule ging es vor allem um die Ausführung zentraler Begriffe innerhalb der befreienden Tradition des Islams, die v.a. seit 1800 in der antiimperialistischen und antikolonialistischen Bewegung „Nahda“ wieder in den Blick gerückt wurden. Dazu zählt der „Ijtihad“, das Prinzip grundlegender persönlicher Reflexions- und Interpretationsmöglichkeit im Verständnis der religiösen Texte in ihrem histo- rischen Kontext. Ebenso der „Tawhid“, die Lehre der Einheit und radikalen Gleichheit unter den Glaubenden über Geschlecht, Herkunft, sexuelle Identität und soziale Klasse hinweg, in der es keine Mittlerfunktion zwischen Gott und Menschen geben kann. Verantwortung (Khilafa), Freiheit (Wilayah) und Gerechtigkeit sind darüber hinaus zentrale Aspekte befreiender islamischer Theologie. Denn der spezifische Charakter der Botschaft des Korans und der Tradi- tion des Propheten (Sunna) ist die Integration der transzendenten, göttlichen Dimension, des wert- vollen Lebens und der sozialen, ökonomischen und politischen Dimensionen der Gemeinschaft.
Politisches Engagement aus islamischer Perspektive
Für Baraka bedeutet dies, dass widerständiges Denken und Handeln auf der Grundlage einer antikapitalistischen, antirassistischen, antikolonialen und antisexistischen Position und der Kritik am dominanten Modell der „modernen“ Welt sowie die Orientierung an positiven Entwicklungen in den Sozialwissenschaften und an Alter- nativmodellen zu den gegenwärtigen Verhältnissen im Mittelpunkt stehen.
Deutlich wurde in dem Workshop, dass Baraka eine Position „zwischen den Stühlen“ einnimmt: Sie sind in ihrem Kampf sowohl den Attacken von Islamophoben und laizistischen Feminist_innen als auch den dominanten kapitalistischen und patriarchalen Überzeugungen ihrer Glaubensgeschwister ausgesetzt. Das Beispiel des Ausschlusses feministischer Muslima aus einem laizistisch-feministischen Protestmarsch erschütterte uns Workshopteilnehmer_innen und führte uns die schwierigen Bedingungen vor Augen, unter denen die Aktivist_innen von Baraka in Frankreich ihre Auseinandersetzungen auszutragen haben.
In Anbetracht ihres bemerkenswerten und ermutigenden Engagements und des guten gegenseitigen Austauschs auf der Sommerschule haben alle Teilnehmer_innen es für wichtig erachtet, weiterhin den Kontakt zu Baraka nach Paris aufrecht zu erhalten und einen Gegenbesuch in Angriff zu nehmen. Mathilde Soukeyna wird einen ausführlichen Text über die Arbeit von Baraka verfassen, der demnächst auf unserer Homepage (www. itpol.de) abrufbar ist.✶
„Die Diktatur erleben wir jetzt“
Zum 40. Jahrestag des Militärputsches in Chile
Barbara Imholz
Drei MitarbeiterInnen des ITP reisten im August nach Chile, um sich ein Bild von der politischen Situation zu machen und Com- paner@s zu besuchen. Von dieser Reise stammen auch die Bilder dieses Rundbriefs.
2011 gingen Hunderttausende in Chile auf die Straße, mitgezogen von Studierenden, die monatelang Universitäten besetzten, um ihren Forderungen nach einem gerechten Bildungssystem Nachdruck zu verleihen. Das Selbstbewusstsein und die Kreativität ihrer Proteste erstaunte die Weltöffentlichkeit: Das neoliberale Modell Chile, das Ergebnis der Diktatur und der nachfolgenden Regierungen, wurde grundlegend delegitimiert.
Chile ist das Land in Lateinamerika mit der höchsten Un- gleichheitsquote: 70% der Bevöl- kerung verdienen nicht mehr als 600 Euro monatlich. Während die Studierenden am Anfang der Proteste nur sich und ihre Familien sahen, ihre Schulden, die schlechte Qualität der Ausbildung, geringe Zukunftschancen wegen der zu erwartenden niedrigen Löhne, haben sie jetzt erkannt, dass das Bildungssystem in seiner neoliberalen Ausprägung unmittelbare Folge des Putsches, der Militärdiktatur und der Transición, der sog. Übergangsregierungen danach, ist. Ihr Kampf politisierte sich zu einem Kampf gegen das neoliberale Modell.
„Wir sind gekommen um zu bleiben“
Alles begann mit dem Aufstand der Pinguine 2006, der Schüler_innen der weiterführenden Schulen, so genannt wegen ihrer schwarz-weißen Schuluniform. Anlass für die Proteste war die fehlende Ausstellung von Busfahrkarten im neu eingeführten System Transsantiago, dem unter Präsident Ricardo Lagos zentralisierten öffentlichen Nahverkehrssystem, das von privaten Unternehmen getragen wurde, aber vor allem in der Anfangsphase nicht funktionierte. Die regulären Transportkosten waren so hoch, dass es zu finanziell ruinösen Situationen in den Familien kam. Das trieb die Schüler_innen nebst Eltern auf die Straße und in die Schulen, um sie zu besetzen. In den folgenden Verhandlungen mit der Regierung Michelle Bachelets wurde viel versprochen, alles „reformiert“, aber im Kern nichts verändert. Diese Erfahrung sollte für die jungen Protestierenden weitreichende Folgen haben: Ihr Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der politischen Repräsentant_innen war zerstört. Fünf Jahre später waren es dieselben Schüler_innen, die nun als Studierende den Aufstand an den Universitäten probten.
Werfen wir einen Blick auf das Schulsystem. In Chile gibt es drei Typen von Schulen: staatliche Schulen, halb subventionierte, halb private Schulen und private Schulen. Die staatlichen Schulen sind schlecht, weil sie schlecht ausgestattet und die Lehrer_innen miserabel bezahlt (durchschnittliches Einkommen für Grundschule und Sekundarstufe I: 600 Euro) werden, mit dem Ergebnis, dass man nach dem Besuch dieser Schule nicht die Aufnahmeprüfung für die Universität bestehen kann. Es ist definitiv die Schule der Armen, die von 40% aller Schüler_innen besucht wird. Die halbprivaten, subventionierten Schulen werden von 50% aller Schüler_innen besucht, vor allem aus der Mittelschicht. Sie kosten ab 40 US-Dollar monatlich, der Rest wird vom Staat getragen. Doch nur 30% der Schulabgänger- _innen dieses Schultyps erreichen den Notendurchschnitt, der für ein Studium an der Universität nötig ist. Die privaten Schulen, 7 % aller Schüler_innen vorbehalten, kosten 300 bis 500 US-Dollar im Monat und bieten tatsächlich bessere Standards. Doch sie müssen wie Unternehmen auf dem freien Markt agieren mit allen Konsequenzen, die dies mit sich bringt, wie Wettbewerb und die Notwendigkeit der Profitmaximierung.
Betrachten wir die Universitäten, setzt sich das Prinzip folgerichtig fort: Auch die staatlichen Universitäten nehmen hohe Gebühren, allerdings heißt es, ihre Ausbildung sei nach wie vor gut. Das gilt für die privaten Universitäten, davon gibt es 60 an der Zahl, dagegen nicht. Sie sind teuer (die Kosten variieren zwischen 150 US-Dollar monatlich für Sozialwissenschaften, 1.200 US-Dollar für Ingenieurwesen und Medizin) und ihre Ausbildung ist schlecht. Sie nehmen natürlich auch diejenigen Schüler_innen auf, die in der Aufnahmeprüfung nur eine geringe Punktzahl erreichten. Die durchschnittliche Studiengebühr liegt damit bei 4000 Euro im Jahr, bei gleichzeitig niedrigen Einkommen. Die Finanzierung läuft natürlich über Kredite mit hoher Verzinsung, so dass man nach 15 Jahren Tilgung in der gleichen Zeit ein Haus hätte erwerben können. Der Mittelstand verschuldet sich über die Maßen, um das Studium der eigenen Kinder zu finanzieren.
De la memoria al poder — aus der Erinnerung an die Macht
In den aktuellen Protesten ist die Vergangenheit ständig präsent: Man erinnert sich der Verschwundenen und aller Ermordeten, die entweder als Protagonist_innen der Unidad Popular für eine gerechte Gesellschaft einstanden oder im Widerstand gegen die Diktatur sterben mussten. Die Folge des Putsches ist die Diktatur, die Folge der Diktatur ist der Neoliberalismus, so machen die Studierenden die Rechnung auf. Daher sagen sie: „Wir erleben die Diktatur jetzt“. Es geht nicht darum, nostalgisch der Unidad Popular, der Volksfront unter ihrem Präsidenten Salvador Allende (1970 bis 1973), nachzu- trauern. Die UP hat eine Niederlage eingesteckt, sagen sie, jetzt geht es darum, ihre Ideen unter neuen Bedingungen in Angriff zu nehmen. Als erstes wollen sie ein anderes Bildungssystem, aber ihre Forderungen gehen mittlerweile viel weiter: Aus der Erinnerung an die Macht!✶
„Wem gehört die Stadt?“
Julia Lis
„Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen, sie werden Reben pflanzen und selbst ihre Früchte genießen. Sie bauen nicht, damit ein anderer in ihrem Haus wohnt, und sie pflanzen nicht, damit ein anderer die Früchte genießt. In meinem Volk werden die Menschen so alt wie die Bäume. Was meine Auserwählten mit eigenen Händen erarbeitet haben, werden sie selber verbrauchen“. (Jes 65, 21f.)
Die biblische Verheißung einer Welt, in der die Menschen selbstbestimmt und frei von Ausbeutung und Unterdrückung leben und wohnen können, klingt auch in heutigen Ohren verlockend. Zugleich macht sie uns bewusst, dass wir von einer solchen Vision weit entfernt sind.
Wohnraum als Ware
In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, in der wir leben, ist auch das Wohnen eine Ware und unterliegt der Logik des Marktes und der Profitmaximierung. Die Folgen dieser Logik erleben wir immer deutlicher in unseren Städten: teure Großprojekte, „gated communities“ und Konsumzwang auf der einen, Verdrängung Wohnungsloser, Ansiedlung von Migrant_innen in Heimen an der Peripherie und steigende Mieten, die sich immer weniger Menschen leisten können, auf der anderen Seite. Städte verwandeln sich in Unternehmen mit eigenem Marketing, das helfen soll, ein investitionsfreundliches Klima zu schaffen. In Zeiten der Finanzkrise verschärft sich die Situation noch weiter: Immobilien gelten als sichere Investition, die Rede ist vom „Betongold“ als hohe Rendite versprechender Geldanlage.
Diese Entwicklung betrifft natürlich nicht alle Städte gleichermaßen; es bildet sich eine deut- liche Polarisierung heraus: Auf der einen Seite gibt es Stadtviertel, die als attraktiv gelten und in denen „Reichenghettos“ entstehen, zum an- deren Viertel, vor allem in der Peripherie der Städte, deren bauliche Substanz zunehmend verfällt und deren Bewohner_innen immer stär- ker vom sozialen und kulturellen Leben der Stadt ausgeschlossen werden. Neben dem „Mietenwahnsinn“, der in manchen Städten ausgebrochen ist und die Woh- nungssuche für ärmere Mieter_innen fast aussichtslos macht, gibt es in anderen Städten, etwa im Osten Deutschlands oder im Ruhrgebiet, massiven Leerstand.
Münster gehört zu den Städten, in denen das Mietniveau in den letzten Jahren immer weiter ansteigt. Mit einer Durchschnittsmiete von 8,50 Euro ist es mittlerweile das dritthöchste in NRW, nur in Düsseldorf und Köln sind die Mieten durchschnittlich noch teurer.
„Die Häuser denen, die drin wohnen“
Gegen diese Entwicklung und die oftmals zynischen Reaktionen der Politik (so erklärte der Düsseldorfer Oberbürgermeister Elbers, Men- schen, die sich die teuren Wohnungen in Düsseldorf nicht leisten können, könnten ja ins Umland ziehen) regt sich Widerstand. So existieren in Berlin, in Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt bereits seit längerer Zeit „Recht-auf-Stadt-Bündnisse“, in denen sich Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen organisieren und gemeinsam Wohnen als ein Menschenrecht für alle postulieren, sich gegen Verdrängung, Zwangsräumungen und Privatisierung wehren und die Partizipation aller an Entscheidungen, die ihr Lebensumfeld betreffen, ein- fordern.
Viele kreative Ideen haben sie dabei entwickelt, um ihren Widerstand in die Öffentlichkeit zu tragen: „Fette-Mieten-Partys“, eine ironische Form des Protestes, die bei Wohnungsbesichtigungen auf die horrenden Mietpreise aufmerksam machen soll, Sitzblockaden, um Zwangsräumungen zu verhindern, „öffentliche Wohnzimmer“ im Freien, die auf die Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche hinweisen oder Antikampagnen, die die Werbesprüche des Stadtmarketings ironisch persiflieren. Zugleich machen die Bündnisse immer wieder deutlich, dass „Recht auf Stadt“ mehr heißt als nur die Kritik an zu hohen Mieten und einer verfehlten Wohnungsbaupolitik. Vielmehr berührt die Forderung nach einer Stadt für alle auch politische Felder wie das des Antirassismus, wenn die Frage nach der angestrebten Unsichtbarkeit von Flüchtlingen in den Städten thematisiert wird, oder die Frage nach den Auswirkungen der europäischen Krisenpolitik auch in der BRD, die zu einem verschärften „Klassenkampf von oben“ führt.
Bei der Aktionswoche, die das Münsteraner Bündnis „Recht auf Stadt“ vom 8.-14. September durchführte, wurden ebenfalls diese unterschiedlichen Facetten des Themas in den Blick genommen: Durch Aktionen, Vorträge und Stadtspaziergänge wurden rassistische Polizeikontrollen an Bahnhöfen ebenso thematisiert wie Immobilienspekulation, Zwangsräumungen und die zunehmende Kameraüberwachung des öffentlichen Raumes.
Istanbul und Brasilien: „Recht auf Stadt“ international
Der Kampf um ein „Recht auf Stadt“, der von der Utopie einer Stadt als Ort guten Lebens für alle ihre Bewohner_innen geprägt ist, ist aber nicht nur lokal ein zentrales Feld der politischen Auseinandersetzungen sozialer Bewegun- gen, sondern auch ein wichtiges Thema sozialer Kämpfe in anderen Teilen der Welt. So entzündeten sich etwa die Proteste dieses Jahres in Istanbul und in Brasilien ebenfalls an Themen, die zum Feld „Recht auf Stadt“ gehören: an der geplanten Überbauung des Gezi-Parks durch ein Einkaufszentrum und an den Preiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr.
Der Kampf gegen die neoliberale Stadt artikuliert sich an unterschiedlichen Orten je anders und neu, dadurch aber, dass Gentrifizierung in der kapitalistischen Stadt ein weltweites Phänomen ist, wird die Stadt nun auch verstärkt zu einem Ort sozialer Proteste, in denen sich breite Bündnisse zusammenfinden, die bis in die bürgerlichen Mittelklassen reichen. Wie die Proteste in Istanbul gezeigt haben, werden hier plötzlich Allianzen zwischen Gruppen möglich, die sich sonst nur wenig zu sagen haben: Gemeinsam demonstrierten dort Angehörige der urbanen Mittel- schicht, Kommunist_innen, Sozialist_innen, Kurd_innen, Gewerkschaftsangehörige, Alevit_innen, Ak- tivist_innen aus der Lesben-, Schwulen- und Transgenderbewegung und Fußballultras.
So bietet das Thema „Recht auf Stadt“ die Chance auf neue Allianzen, breite soziale Mobilisierungen und die Hoffnung, das aus diesen Käm- pfen neue Perspektiven einer gerechten, solidarischen und gemeinschaftlichen Stadt ent- stehen können. Dazu gilt es, lokal die Widerstände zu organisieren, Bündnisse und Initiativen zu gründen, Verdrängung und Ausgrenzung vor der eigenen Haustür nicht tatenlos hinzunehmen, sondern dagegen zu protestieren. Dabei bleibt es aber auch wichtig, den globalen Aspekt im Auge zu behalten, Verbindungslinien zwischen den verschiedenen Kämpfen zu analysieren und daraus gemeinsam und international Ideen zu entwickeln, die uns der Utopie einer nach den Wünschen der Vielen, die dort leben, und nicht der Wenigen, die von ihr profitieren, gestalteten Stadt näher bringen können.✶