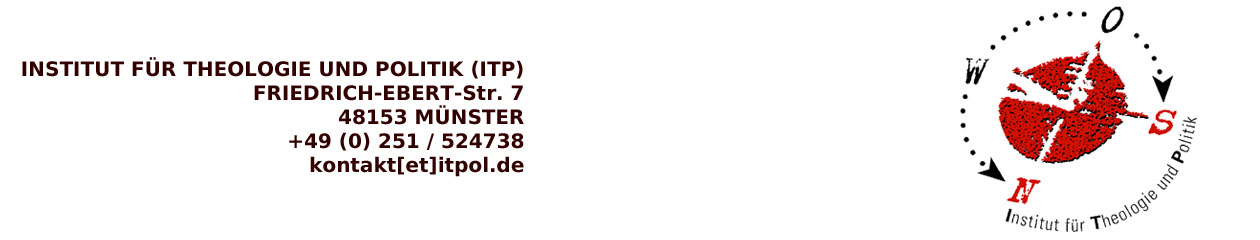„Ein Fenster aufmachen für die Welt“
Interview mit Papst Franziskus vom 9. Juni 2014
Vorbemerkung:
Am Montag, dem 9. Juni 2014, einen Tag nach dem Friedensgebet mit den Präsidenten Israels und Palästina, gab Papst Franziskus der spanischen Tageszeitung „La Vanguardia“ aus Katalonien ein Interview. Radio Vatikan hat Auszüge aus diesem Interview in deutscher Sprache veröffentlicht, die m. E. der Brisanz der Aussagen des Papstes nicht gerecht werden ( http://de.radiovaticana.va/news/2014/06/13/papst-interview:_„ich_habe_kein_persönliches_projekt_unterm_arm,/ted-806669 ). Deshalb habe ich eine eigene Übersetzung erstellt.
Norbert Arntz
(Franziskus)
Die verfolgten Christen sind eine Sorge, die mich als Hirte sehr bewegt. Ich weiß sehr viel über Verfolgungen, es scheint mir jedoch nicht klug zu sein, hier offen darüber zu sprechen, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Aber hier und da ist es verboten, eine Bibel zu besitzen oder den Katechismus zu lehren oder ein Kreuz zu tragen.
(LV) Die Gewalt im Namen Gottes prägt den Nahen Osten…
(Franziskus) Das ist ein Widerspruch. Gewalt im Namen Gottes passt nicht in unsere Zeit. Das liegt längst hinter uns. Im Blick auf die Geschichte müssen wir eingestehen, dass wir Christen diese Gewalt hin und wieder praktiziert haben. Wenn ich an den Dreißigjährigen Krieg denke, dann war das Gewalt im Namen Gottes. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, nicht wahr? Aus religiösen Gründen verwickeln wir uns manchmal in sehr ernste, sehr schwerwiegende Widersprüche. Zum Beispiel der Fundamentalismus. Wir drei Religionen haben jeweils unsere fundamentalistischen Gruppen, im Verhältnis zum Ganzen sind es nur kleine Gruppen.
Wie denken Sie über den Fundamentalismus?
Eine fundamentalistische Gruppe ist gewalttätig, selbst wenn sie niemanden tötet, niemanden schlägt. Die geistige Struktur des Fundamentalismus bedeutet Gewalt im Namen Gottes.
Manche sagen von Ihnen, Sie seien ein Revolutionär…
Wir müssten die große italienische Sängerin Mina Mazzini anrufen und ihr sagen „nimm diese Hand, Zinga“, damit sie meine Vergangenheit deutet. Mal sehen, was dabei herauskäme. (Lachen). Für mich ist die entscheidende Revolution zurück zu den Wurzeln, sie anzuerkennen und zu schauen, was diese Wurzeln uns heute zu sagen haben. Es gibt keinen Widerspruch zwischen revolutionär und zurück zu den Wurzeln. Vielmehr glaube ich, dass echte Veränderungen nur durch Identität möglich werden. Man kann im Leben nur vorankommen auf der Basis dessen, was hinter einem liegt, wenn ich weiß, woher ich komme, wie ich heiße, wie ich kulturell und religiös heiße.
Sie haben oft das Sicherheits-Protokoll gebrochen, um den Menschen nahe zu sein…
Ich weiß, dass mir mal etwas passieren kann, aber das liegt in den Händen Gottes. Ich erinnere mich, dass man in Brasilien für mich ein geschlossenes Papamobil mit Panzerglas vorbereitet hatte. Aber ich kann die Leute weder grüßen noch ihnen sagen, dass ich sie mag, und dabei in einer Sardinendose stecken, selbst wenn sie aus Glas ist. Das ist für mich eine Mauer. Sicher kann mir was passieren, aber seien wir realistisch, in meinem Alter habe ich nicht mehr viel zu verlieren.
Warum sollte die Kirche arm und demütig sein?
Armut und Demut gehören zur Mitte des Evangeliums, und das meine ich in theologischer, nicht soziologischer Bedeutung. Man kann das Evangelium nicht verstehen ohne die Armut, aber man muss sie vom Pauperismus unterscheiden. Ich glaube, Jesus will, dass wir Bischöfe keine Fürsten, sondern Diener sind.
Was kann die Kirche tun, um die wachsende Ungleichheit zwischen Reichen und Armen zu reduzieren?
„Es ist bewiesen, dass wir mit der Nahrung, die übrigbleibt, die Hungernden ernähren könnten. Wenn man Fotos von unterernährten Kindern in verschiedenen Teilen der Welt sieht, dann fasst man sich an den Kopf. Das ist nicht zu verstehen! Ich glaube, wir sind in einem Weltwirtschaftssystem, das nicht gut ist. Im Zentrum jedes Wirtschaftssystems muss der Mensch stehen, der Mann und die Frau, und alles Übrige hat den Menschen zu dienen. Aber wir haben das Geld ins Zentrum gerückt, das Geld zu Gott gemacht. Wir sind einer Sünde des Götzendienstes verfallen, dem Götzendienst des Geldes. Die Wirtschaft wird nur vom Bestreben in Gang gehalten, immer mehr zu haben. Und paradoxerweise betreibt man gleichzeitig eine Kultur des Ausschlusses. Man schließt die Jugendlichen aus, wenn man die Anzahl der Geburten einschränkt. Man schließt auch die Alten aus, weil sie nichts mehr nützen, nicht produzieren, weil sie eine passive Klasse sind. Indem man die Kinder und die Alten ausschließt, schließt man auch die Zukunft eines ganzen Volkes aus. Denn die Kinder werden mit aller Macht nach vorne drängen und die Alten lassen uns an ihrer Weisheit teilhaben, sie sind das lebendige Gedächtnis des Volkes und sollen es den Jugendlichen weitergeben. Jetzt ist es auch Mode geworden, die Jugendlichen durch Arbeitslosigkeit auszuschließen. Die Arbeitslosenzahlen unter Jugendlichen machen mir große Sorgen; in manchen Ländern beträgt der Index mehr als 50 %. Jemand hat mir gesagt, dass in Europa 75 Millionen Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos sind. Das ist Wahnsinn. Wir schließen eine ganze Generation aus, um ein Wirtschaftssystem aufrecht zu erhalten, das nicht mehr zu ertragen ist. Ein System, das Krieg führen muss, um zu überleben, wie es die großen Imperien immer getan haben. Aber weil man keinen Dritten Weltkrieg führen kann, führt man eben regionale Kriege. Und was bedeutet das? Dass Waffen produziert und verkauft werden. Dadurch wird offenbar die Bilanz der Götzendienst-Wirtschaft saniert, so sanieren sich die wichtigsten Wirtschaftsblöcke der Welt, die dem Götzen Geld den Menschen als ein Opfer vor die Füße legen. Dieses Einheitsdenken beraubt uns des Reichtums der Unterschiede im Denken und folglich des Reichtums, der im Dialog zwischen den Menschen besteht. Die wohlverstandene Globalisierung bedeutet eine Bereicherung. Die missverstandene Globalisierung besteht darin, Unterschiede zu beseitigen. Sie wirkt wie eine Kugel, in der alle Punkte auf gleiche Distanz vom Zentrum gehalten werden. Eine Globalisierung, die reicher macht, ist dagegen wie ein Vieleck, in dem alle miteinander verbunden sind, aber jeder seine Besonderheit, seinen eigenen Reichtum, seine Identität behält. Das aber ist nicht der Fall.
Sind Sie besorgt über den Konflikt zwischen Katalonien und Spanien?
Jede Spaltung macht mich besorgt. Es gibt Unabhängigkeit auf Grund von Emanzipation und Unabhängigkeit auf Grund von Abspaltung. Unabhängigkeiten auf Grund von Emanzipation sind z.B. die amerikanischen, sie emanzipierten sich von den europäischen Staaten. Unabhängigkeiten von Völkern auf Grund von Abspaltung, das ist eine Zergliederung. Das ist hin und wieder offenkundig. Denken wir an das frühere Jugoslawien. Natürlich gibt es Völker, in denen die verschiedenen Kulturen überhaupt nicht zusammen passen. Der Fall Jugoslawien ist ganz eindeutig. Aber ich frage mich, ob es in anderen Fällen so eindeutig ist, bei anderen Völkern, die bis jetzt zusammengehört haben. Man muss Fall für Fall studieren. Schottland, Padanien, Katalonien. Es wird berechtigte und nicht berechtigte Fälle geben, aber sich von einer Nation abzuspalten, ohne zuvor gewaltsam zur Einheit gebracht worden zu sein, das muss man sehr behutsam anfassen und Fall für Fall analysieren.
Das Friedensgebet im Vatikan am Sonntag war nicht leicht zu organisieren; dafür gab es weder im Nahen Osten noch in der Welt einen Präzedenzfall. Wie fühlten Sie sich dabei?
Wissen Sie, das war nicht einfach. Du bist selbst mit im Spiel und Du weisst, von Dir hängt ein Großteil des Erfolges ab. Ich spürte, dass das Ganze nicht nur in unseren Händen lag. Hier im Vatikan sagten 99 Prozent, dass das nicht klappen würde, und danach wurde das eine Prozent immer größer. Ich spürte, dass wir uns da zu etwas gedrängt sahen, das nicht uns selbst in den Sinn gekommen war und das allmählich Gestalt annahm. Es war überhaupt kein politischer Vorgang, das spürte ich von Anfang an, sondern ein religiöser Vorgang: für die Welt ein Fenster aufmachen.
Warum haben Sie entschieden, sich ins Auge des Taifuns, in den Nahen Osten zu begeben?
Das wirkliche Auge des Taifuns war der Weltjugendtag von Rio im letzten Jahr!– und zwar wegen der Begeisterung, die da herrschte. Ins Heilige Land zu reisen, habe ich entschieden, weil Präsident Peres mich einlud. Ich wusste, dass seine Amtszeit in diesem Frühjahr zu Ende ging, und fühlte mich gewissermaßen dazu verpflichtet, noch vorher zu fahren. Seine Einladung hat den Reisetermin beschleunigt. Ich hatte das eigentlich nicht so geplant.
Warum ist es für jeden Christen so wichtig, Jerusalem und das Heilige Land zu besuchen?
Wegen der Offenbarung. Für uns begann hier alles. Es ist wie „der Himmel auf Erden“, eine Vorwegnahme dessen, was uns im Jenseits erwartet, im himmlischen Jerusalem.
Sie haben Ihren Freund, den Rabbiner Skorka vor der Klagemauer umarmt. Welche Bedeutung hat dieser Gestus für die Versöhnung zwischen Christen und Juden?
Nun, vor der Mauer war auch noch mein guter Freund, Professor Imar Abu, Präsident des Instituts für den Interreligiösen Dialog von Buenos Aires. Es war mir ein Anliegen, auch ihn einzuladen. Er ist ein sehr frommer Mann, Vater von zwei Söhnen, und ebenfalls mit dem Rabbiner Skorka befreundet. Beide habe ich sehr gern. Ich wollte, dass man die Freundschaft zwischen uns Dreien als Zeugnis begreife.
Vor einem Jahr haben Sie mir gesagt, dass in jedem Christen ein Jude steckt…
Am angemessensten wäre wohl zu sagen: „Sie können Ihren christlichen Glauben, Sie können Ihr Christsein nicht wirklich leben, wenn Sie nicht dessen jüdische Wurzel anerkennen.“ Ich spreche vom Judentum nicht in rassischer, semitischer Bedeutung, sondern im religiösen Sinn. Meiner Meinung nach muss der interreligiöse Dialog sich damit vertieft auseinandersetzen, mit der jüdischen Wurzel des Christentums, mit dem christlichen Zweig auf dem Baum des Judentum. Ich verstehe, dass das eine Herausforderung ist, eine heiße Kartoffel, aber als Brüder können wir das tun. Jeden Tag bete ich im Breviergebet die Psalmen Davids. Innerhalb einer Woche lesen wir alle 150 Psalmen. Mein Gebet ist jüdisch und dann feiere ich die Eucharistie, und die ist christlich.
Was sagen Sie zum Antisemitismus?
Ich könnte keine Gründe dafür darlegen, warum es ihn gibt. Aber ich glaube, er hängt im Allgemeinen, ohne daraus jetzt wieder eine feste Regel machen zu wollen, sehr mit der politischen Rechten zusammen. Der Antisemitismus fasst üblicherweise besser in politisch rechtsorientierten Strömungen Fuß als in den linksorientierten, nicht wahr? Und zwar immer noch. Wir haben es sogar mit Leuten zu tun, die den Holocaust leugnen – ein Wahnsinn!
Eines Ihrer Projekte ist es, die Vatikan-Archive zum Holocaust zu öffnen.
Sie werden viel Licht in die Sache bringen.
Machen Sie sich über irgendetwas Sorgen, was man dabei entdecken könnte?
Was mir bei diesem Thema Sorgen macht, ist die Gestalt Pius‘ XII., des Papstes, der während des Zweiten Weltkrieges die Kirche leitete. Dem armen Pius XII. wurde wirklich alles Mögliche vorgeworfen. Aber man muss daran erinnern, dass man ihn früher einmal als bedeutsamen Verteidiger der Juden angesehen hat. Er hat viele in den Klöstern Roms und anderer italienischer Städte versteckt, auch in der Sommerresidenz Castel Gandolfo. Dort, im Zimmer des Papstes, in seinem eigenen Bett, wurden 42 Babys geboren, Kinder von Juden und anderen Verfolgten, die dorthin geflohen waren. Ich will damit nicht behaupten, dass Pius XII. alles richtig gemacht hat – ich selbst mache auch vieles falsch –, aber man muss seine Rolle im Zusammenhang mit diesem Zeitabschnitt interpretieren. War es zum Beispiel besser, zu schweigen oder zu reden, um nicht noch mehr Juden in Todesgefahr zu bringen? Ich will auch aussprechen, dass es mich manchmal wütend macht, wenn ich sehe, dass alle über die Kirche und Pius XII. herfallen, aber nichts zu den Großmächten sagen. Wissen Sie, dass die Großmächte das Eisenbahnnetz der Nazis, auf dem die Juden in die Konzentrationslager gebracht wurden, ganz genau kannten? Sie hatten Fotos davon! Aber diese Zugverbindungen haben sie nicht bombardiert. Warum? Darüber sollten wir auch mal sprechen!
Verstehen Sie sich immer noch als Pfarrer oder haben Sie Ihre Rolle an der Spitze der Kirche akzeptiert?
Das Pfarrersein macht meine Berufung am besten deutlich. Für die Leute dazusein, ist mein innerster Antrieb. Ich mache zum Beispiel das Licht aus, um Geld zu sparen. Solche Dinge tut ein Pfarrer. Aber ich verstehe mich auch als Papst. Das verhilft mir dazu, allen Dingen ihren eigenen Rang zu geben. Meine Mitarbeiter sind mit professionellem Ernst bei der Sache. Sie sind mir dabei behilflich, meinen Aufgaben gerecht zu werden. Ich will als Papst nicht den Pfarrer spielen. Das wäre unangemessen. Wenn ein Staatschef zu Besuch kommt, habe ich ihn so zu empfangen. wie es die Würde des Amtes und das Protokoll verlangen. Sicher habe ich mit dem Protokoll meine Probleme, aber ich habe es zu respektieren.
Sie ändern viele Dinge. Wohin führen diese Änderungen?
Ich bin kein Wahrsager. Ich habe kein persönliches Projekt mit gebracht, und zwar ganz einfach deshalb, weil ich niemals daran gedacht habe, dass man mich hier im Vatikan behalten würde. Das wissen alle. Ich bin mit kleinem Gepräck gekommen, um (nach dem Konklave) sofort nach Buenos Aires zurückzukehren. Ich tue, was ich tue nur, um das umzusetzen, was wir Kardinäle bei den Generalkongregationen überlegt haben, das heißt, bei den täglichen Versammlungen, die wir während des Konklave abhielten, um die Probleme der Kirche zu diskutieren. Daraus ergaben sich Überlegungen und Empfehlungen. Eine sehr konkrete Empfehlung lautete, dass sich der nächste Papst auf ein Beratungsgremium von außen stützen sollte, das heißt, ein Team von Assessoren haben sollte, die nicht im Vatikan wohnen.
Sie haben daraufhin den sogenannten Rat der acht Kardinäle geschaffen.
Acht Kardinäle aus allen Kontinenten mit einem Koordinator. Sie treffen sich hier alle zwei bzw. drei Monate. Anfang Juli haben wir jetzt vier Tage für die Zusammenkunft, und wir werden die Änderungen vornehmen, die die Kardinäle selbst fordern. Das müssen wir zwar nicht machen, aber es wäre unklug, nicht auf die zu hören, die Ahnung haben.
Sie haben sich auch sehr um die Annäherung an die orthodoxe Kirche bemüht.
Mein Bruder Bartholomäus I ist nach Jerusalem gekommen, um des fünfzigsten Jahrestages der Begegnung zwischen Paul VI. und Athenagoras zu gedenken. Das war damals das erste Treffen nach mehr als tausend Jahren der Trennung. Seit dem II. Vatikanischen Konzil bemüht sich die katholische Kirche um diese Annäherung und die orthodoxe Kirche ebenso. Einigen orthodoxen Kirchen stehen wir näher als anderen. Ich hatte den Wunsch, dass Bartholomäus I. mit mir in Jerusalem wäre. Und da entstand dann der Plan, dass er auch zum (Friedens-)Gebet in den Vatikan käme. Das war für ihn ein riskanter Schritt, weil man ihm das zum Vorwurf machen konnte. Aber in diesem Gestus demütiger Haltung mussten wir einander die Hände reichen. Und wir brauchen das, weil man nicht mehr versteht, warum wir Christen gespalten sind. Es ist eine Sünde der Geschichte, die wir wieder gut machen müssen.
Angesichts der Ausbreitung des Atheismus, was halten sie von den Menschen, die glauben, dass sich Wissenschaft und Religion nicht miteinander vereinbaren lassen?
Der Atheismus breitete sich stärker in der existenzphilosophischen Phase aus, vielleicht zur Zeit Sartres. Danach aber begann eine stärkere spirituelle Suche, eine Suche nach der Begegnung mit Gott auf tausenderlei verschiedene Weise, nicht notwendigerweise in den traditionellen Religionen. Die Konfrontation zwischen Wissenschaft und Glaube war in der Zeit Aufklärung besonders stark, aber heutzutage ist sie, Gott sei Dank, nicht mehr so bedeutsam, weil wir alle gemerkt haben, wie nahe sich beide sind. Papst Benedikt XVI. hat zur Beziehung zwischen Wissenschaft und Glaube hilfreiche Lehraussagen getroffen. Ganz allgemein gesprochen ist es heute doch üblich geworden, dass die Wissenschaftler sehr respektvoll den Glauben behandeln und der agnostische oder atheistische Wissenschaftler sagt, „ich wage mich nicht auf dieses Feld vor.“
Sie haben viele Staatschefs kennengelernt.
Viele sind gekommen. Die Vielfalt ist interessant. Jeder bringt seine eigene Persönlichkeit mit. Mir ist besonders bei den jungen Politikern aufgefallen, dass sie quer über alle Lager – ob aus der Mitte, von links oder von recht – etwas gemeinsam haben. Sie reden möglicherweise über die gleichen Probleme, aber in einem anderen Ton. Und das gefällt mir. Das lässt mich hoffen, denn die Politik ist eine der höchsten Formen der Liebe, der Nächstenliebe. Warum? Weil sie zum Gemeinwohl führt. Ein Mensch, der sich nicht um des Gemeinwohls willen auf die Politik einlässt, obwohl er es könnte, handelt egoistisch bzw. verwendet die Politik zum eigenen Nutzen. Das ist korruptes Verhalten. Vor etwa 15 Jahren veröffentlichten die französischen Bischöfe einen Pastoralbrief, in dem sie über das Thema „Réhabiliter la politique“ (Die Politik rehabilitieren) nachdachten. Das ist ein hervorragender Text, der macht dich auf all diese Dinge aufmerksam.
Was denken Sie zum Rücktritt von Benedikt XVI.?
Papst Benedikt hat einen sehr wichtigen Schritt getan. Er hat eine Tür geöffnet, eine Institution geschaffen, nämlich von möglichen emeritierten Päpsten. Vor 70 Jahren gab es keine emeritierten Bischöfe. Und wie viele gibt es heute? Nun, weil wir alle länger leben, kommen wir auch in ein Alter, in dem wir die Dinge nicht mehr voran bringen können. Ich will dasselbe tun wie er, auch ich will den Herrn bitten, dass er es mich wissen lässt, wann der Moment gekommen ist, und dass er mir sagt, was ich tun soll. Das wird er sicher tun.
Haben Sie sich schon eine Wohnung in einem Altenheim von Buenos Aires reserviert?
Ja, in einem Heim für alte Priester. Ich wollte das Amt des Erzbischofs Ende des vergangenen Jahres aufgeben und hatte Papst Benedikt meinen Rücktritt angeboten, als ich 75 Jahre alt wurde. Ich hatte mir eine Wohnung ausgesucht und mich entschieden, „hierher will ich kommen und leben“. Ich will in der Pastoral mit tätig sein und in Pfarreien helfen. Das sollte meine Zukunft sein, bevor ich Papst wurde.
Ich werde Sie nicht fragen, wem Sie bei der Fußballweltmeisterschaft die Daumen drücken…
Die Brasilianer haben mich darum gebeten, neutral zu bleiben (lacht), und ich stehe zu meinem Wort, denn Brasilien und Argentinien stoßen immer wieder aufeinander.
Wie möchten Sie in Erinnerung bleiben?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber mir gefällt, wenn jemand an einen anderen denkt und von ihm sagt: „Er war ein guter Kerl, er tat was er konnte, so schlecht war er nicht“. Damit wäre ich zufrieden.